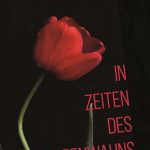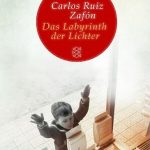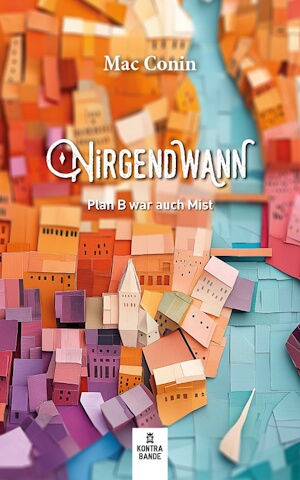
Im April 2025 erschien der Roman Nirgendwann des deutschen Autors Mac Conin. Er handelt von einem krisenhaften Lebensabschnitt der jungen Wahlkölnerin Johanna, genannt Jo, die sich zwischen den Wunschvorstellungen für ihr Leben und den harten Realitäten des Lebens in einer Großstadt bewegt. Aber wo Hoffnung ist, dort tun sich auch Wege auf. Dürfen wir optimistisch sein, dass aus dem Nirgendwann vielleicht doch ein Irgendwann und Irgendwo wird?
Bevor ich mich in die Erzählung stürze, möchte ich noch auf die auffällige Gestaltung des Buchumschlags hinweisen. Es handelt sich um eine Art buntes Kartonstadtmodell des Kölner Zentrums am Rhein, das ein wenig an naive Kunst erinnert. Sehr ansprechend, wirklich gut gemacht, das hebt sich von vielen der gewohnten, gewöhnlichen Buchcovern ab¹. Und wenn man sich einmal auf der Website des Verlags umsieht, wird man feststellen, dass auch die Gestaltung anderer Titel etwas Außergewöhnliches hat. Das muss wohl an der Leitung des Verlagsprojekts liegen. – Doch darüber später mehr. Jetzt: in medias res!
Über die Romanhandlung
Gleich einmal vorab: Wir müssen unterscheiden zwischen der Handlung der Romangeschichte und dem, worum es tatsächlich im Text geht. Die Handlung lässt sich – auch ohne den Inhalt zu spoilern – recht kurz zusammenfassen: Eine junge, ziemlich sprunghafte Frau namens Johanna Siewers, genannt Jo, landet in Köln. Sie hat mit Anfang zwanzig Hals über Kopf ihr Elternhaus in der Eifel verlassen, um den körperlichen Übergriffen ihres jähzornigen Vaters und dem Terror ihrer alkoholkranken Mutter zu entgehen. Ihre beiden jüngeren Geschwister, beide noch im Schulalter, musste sie zunächst bei den Eltern zurücklassen. In der Großstadt am Rhein trifft Jo schon wieder auf Menschen, die sie ausbeuten; aber überraschenderweise auch auf solche, die sie unterstützen.
Jos Erlebnisse mäandern achterbahnartig durch die Geschichte, selbst nachdem sie einen habgierigen Vermieter und den übergriffigen Chef in ihrem Kellnerjob loswird. Eine vorübergehende Stabilisierung erreicht Jo nur mit Hilfe des gleichaltrigen IT-Nerds Carlo und dessen Wohnungsnachbarn, Herrn Hänsel, einem beinahe achtzigjährigen Witwer, der die junge Frau bei sich aufnimmt. Aus der Zweckgemeinschaft zwischen dem älteren Herrn und seinem Schützling entwickelt sich schnell eine für beide Seiten gewinnbringende Verbundenheit.
Allerdings wird Jo trotzdem wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Besser gesagt von ihren Vergangenheiten! Denn der aufdringliche Ex-Chef lässt nicht davon ab, Jo zu stalken. Und nach einem Amoklauf ihres Vaters in der Eifel muss Jo ihre beiden jüngeren Geschwister Pete und Hella abholen und holterdiepolter mit nach Köln nehmen. Doch obwohl Hänsel und Carlo die drei Geschwister nach besten Möglichkeiten unterstützen, ist erkennbar, dass ihre Mittel begrenzt sind und die Zwischenlösung auf Dauer nicht gut gehen wird.
Worum es geht
Wie gesagt geht es nur oberflächlich um diesen chaotischen Lebensabschnitt der Protagonistin. Tatsächlich hangelt sich der Autor an einigen wenigen Monaten im Leben von Johanna entlang und bespricht dabei großstädtische Entwicklungen am Beispiel der Kölner Südstadt. Dabei lässt er abwechseln seine Darsteller zu Wort kommen, entweder in der dritten Person, oder sogar in Ich-Erzählungen. Die einzelnen Kapitel sind äußerst kurz gehalten, sie gehen nur selten über drei, vier Textseiten hinaus. Den Haupterzählanteil hat sicher Johanna. Aber gleich danach folgt der Witwer Hänsel. Auch Jos Bruder Pete, ihre Schwester Hella und IT-Carlo (und sogar dessen Hauskater) kommen mehrmals zu Wort.
Das „Büdchen“
Zwischendurch schiebt Conin immer wieder sehr kurze Kapitel ein, in denen ein Kiosk an der Zülpicher Straße in Köln als Erzähler auftritt; das „Büdchen“. Das muss man im wörtlichen Sinn verstehen. Denn in immerhin sechzehn von den insgesamt dreiundachtzig Romankapitelchen spricht dieses Büdchen nicht als Person, sondern als Einrichtung die Leserschaft an. In diesen Passagen geht es selten um die Handlung. Der Großteil der Büdchenauftritte sind von gesellschaftlichen Kommentaren geprägt: Von der historischen Rolle dieser Kioske, von der abnehmenden Bedeutung zwischenmenschlicher Kontakte, von Entfremdung und Vereinsamung; im Großen und Ganze schlichtweg von städtischer Entwicklung und von der Digitalisierung der Kommunikationswege an Stelle von Klatsch und Tratsch auf den Straßen.
Es ist offensichtlich, dass der Autor das Büdchen als persönliches Sprachrohr in seiner Geschicht nutzt. Immer wieder baut er Aussagen und Theorien von insgesamt vierzehn Denkern oder Theoretikern in seine Büdchentexte ein, um gesellschaftliche Entwicklungen oder Tendenzen zu illustrieren².
„Ich sehe die Leute in meinem Viertel kommen und gehen. […] Es fühlt sich so an, als ob sie versuchen zu überleben, und nicht einmal so weit kommen, dass sie hier auch sesshaft werden könnten. […] Zygmunt Baumann hat das mal »die flüssige Moderne« genannt. Er hatte recht. Stabilität? Gibt es nicht mehr. Mein Viertel zeigt das ziemlich gut.“
(Büdchen, Seite 103)
In der Summe verleihen solche Einschübe der Geschichte eine unvermutete, beinahe wissenschaftliche oder zumindest gesellschaftsanalytische Komponente. Auch wenn zu befürchten ist, dass beileibe nicht alle Leser¦innen diesen Gedankengängen folgen werden.
Erfolgsrezept
Ist Nirgendwann nun ein Entwicklungsroman? Sozialdrama? Gesellschaftskritik? Reine Unterhaltungslektüre mit spritzigen Dialogen und viel Humor? – Im besten Fall kann man das sogar alles aus der Geschichte herauslesen.
Conin macht uns die Lektüre leicht. Die übersichtlich kurzen Kapitel hatte ich bereits erwähnt. Außerdem bedient sich der Autor fast durchgehend einer auffallenden Kleinteiligkeit. Alltagsverrichtungen werden in ungewöhnlichem, spaßigen Detaillierungsgrad beschrieben: Duschen, Haushaltstätigkeiten und letztlich erfahren wir sogar, wie viele Socken und in welchen Farben Jo ihrem Gastgeber Hänsel bei einer dringend notwendigen Stilberatung aufschwätzt. Nun könnte man meinen, dass das auf die Dauer anstrengend wird. Doch erstaunlicherweise war das bei mir nicht der Fall. Ich habe mich durch die knapp vierhundert Buchseiten geradezu hindurchgefräst. Der Schreibstil passt gut zur impulsiven Art der Romanheldin.
Man sollte allerdings aufpassen, bei Erzählerwechseln – insbesondere zu Hänsel, oder noch mehr beim Büdchen – den Rhythmus- oder Stimmungswechsel nicht zu überlesen. Manchmal musste ich an solchen Stellen ein paar Absätze zurückspringen. Ziemlich überrascht – enttäuscht möchte ich jedoch nicht sagen! – hat mich dann die finale Auflösung, das Ende der Geschichte. Das ging aber mal ruckzuck im Vergleich zu den sonstigen immer wiederkehrenden Gedankengängen und dem teilweise repetitiven Handlungsablauf.
Über den Autor
Ich vermute, dass es sich noch nicht deutschlandweit herumgesprochen hat, wer dieser Mac Conin ist. Deshalb notiere ich einmal, was man über den Mann herausfinden kann, das über seinen schlanken Wikipediaeintrag hinausgeht. Conin wurde 1961 in Köln geboren, ist dort aufgewachsen und nach Zwischenstationen in Bonn, München und in den USA auch wieder in der Domstadt am Rhein gelandet. Conin führt eine Werbeagentur, unter deren Mantel er das Verlagsprojekt Kontrabande betreibt. Diese Elternschaft tut vor allem der Gestaltung von Buchcovern gut, wie ich bereits ganz zu Anfang dieser Besprechung angemerkt habe.
Bei Kontrabande hat der Autor im Januar 2025 seinen Erstling Himmelsstürmer und nur drei Monate später den Roman Nirgendwann veröffentlicht. Beim Büchertreff verrät uns der Autor, dass er schon seit Jahren schreibt, jetzt allerdings Ernst damit macht.
Interessantes Detail am Rande ist übrigens, dass viele Bücher im Kontrabande Verlag sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch herausgegeben werden, so auch Himmelsstürmer | Above the Noise und Nirgendwann | Neverwhere. Bei englischsprachigen Originaltiteln des Verlags wird jeweils Mac Conin als Übersetzer genannt³.
Diese Autoreninformationen notiere ich übrigens hier in meiner Besprechung, weil mich die Zielstrebigkeit einer solchen Vorgehensweise durchaus beeindruckt. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht.
~
Hinweis: Im Buchhandel habe ich Nirgendwann zwar problemlos gefunden, allerdings lediglich als eBook. Wer sich für das haptische Buch interessiert, sollte sich vielleicht an den Kontrabande Verlag wenden. Es heißt, es gäbe dort auch Exemplare mit Widmung.
Fazit:
Nirgendwann ist eine in vielerlei Hinsicht überraschende Romangeschichte. Nach dem Einstieg hätte ich nicht damit gerechnet, den Text gleich noch ein zweites Mal lesen zu wollen. Aber so ist es tatsächlich gekommen. Und nachdem ich in der Danksagung am Ende des Buchs erfahren durfte, dass auch der Autor einige lose Enden bemerkt hat, freue ich mich schon ein bisschen, dass es da vielleicht eine Art Fortsetzung geben könnte. Auch wenn das eine echte Herausforderung sein würde. Aber zum Beispiel die komplexe Figur des Herrn Hänsel ist mir tatsächlich ein wenig zu kurz gekommen.
Ich empfehle die Romangeschichte all den Leser¦innen, die eine spritzige Erzählung zu schätzen wissen und sich dabei von Sprunghaftigkeit und diametralen Stimmungsschwankungen der zentralen Romanfigur nicht abschrecken lassen. Insbesondere aber gilt meine Empfehlung denjenigen, die bei aller Freude an Leichtfüßigkeit die Augenblicke nicht verpassen, in denen Zäsuren stattfinden; und in denen man bei der Lektüre vielleicht einmal ein paar Minuten innehalten und nachdenken sollte. Ach ja, natürlich sollte sich vor allem die eine Million Kölner Nirgendwann nicht entgehen lasse!
Ich war selbst einigermaßen erstaunt darüber, dass mein unbestechlicher Bewertungsalgorithmus ziemlich klare vier von fünf möglichen Sternen ausgespuckt hat. Aber auch gefühlsmäßig kann ich dieses Ergebnis durchaus vertreten.
Mac Conin, Nirgendwann
Kontrabande Verlag, 2025
Ich bedanke mich herzlich bei Mac Conin, dem Autor des Romans, für das Rezensionsexemplar
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)
Fußnoten:
¹ — Auf der Verlagsseite des Romans findet sich der Hinweis darauf, die Grafik sei „unter Verwendung von Teilen von midjourney“, einer KI-Anwendung entstanden.
² —Ein Verzeichnis dieser Autoren und ihrer zentralen Aussagen findet sich am Ende des Romans ab Seite 398.
³ — Ich habe in diesem Zusammenhang neu aufgelegte Werke von Richard Henry Dana († 1882), John Meade Falkner († 1932), Lucy Maud Montgomery († 1942) und William Clark Russel († 1911) gefunden.