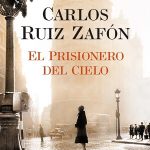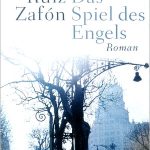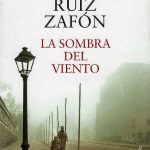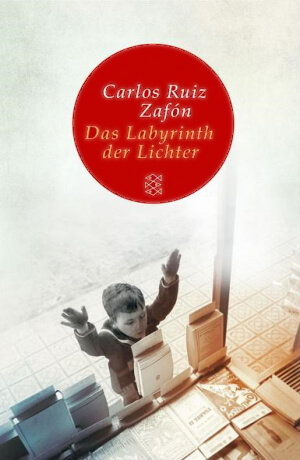
Mit dem Roman Das Labyrinth der Lichter schließt Carlos Ruiz Zafón seinen vierbändigen Zyklus um den Friedhof der Vergessenen Bücher im Herzen Barcelonas ab. Fünfzehn Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes, Der Schatten des Windes, beendet also der weltweit am meisten verkaufte spanischsprachige Autor sein Meisterwerk; nach 2.576 Buchseiten und 27 Millionen gedruckten Exemplaren. In einem Fernsehinterview* schwört der Bestsellerautor mit der Rechten auf seinem letzten Romanband, dass nun definitiv Schluss sein wird. Einen Gutteil seines Erwachsenenlebens habe ihn die Geschichte beschäftigt, zwischen 36 und 51, erzählt Ruiz Zafón. Nun sei es endlich Zeit für ein neues Projekt. Damals ahnte jedoch noch niemand, dass der Autor nur vier Jahre später tot sein würde.
Die Tetralogie kreist zwar um ein zentrales Motiv, eben um diesen sagenumwobenen Friedhof der Vergessenen Bücher in Barcelona, der katalanischen Metropole am Mittelmeer. Doch es sind vier sehr unterschiedliche Romane, die der Autor abgeliefert hat. Denn jeder der Bände hat seinen eigenen Protagonisten und gehört einem anderen literarischen Genre an: Der Schatten des Windes ist nämlich im Kern ein Coming-of-Age-Roman um den jungen Daniel Sempere. Das Spiel des Engels ist eine mystische Schauergeschichte, dessen Hauptfigur der Schriftsteller David Martín ist. Teil drei, Der Gefangene des Himmels, stellt einen Abenteuerroman um die pittoreske Figur des Fermín Romero de Torres dar. Und nun, den vierten und letzten Teil, den muss man in erster Linie wohl als spannende Krimigeschichte lesen, deren zentrale Figur eine junge Geheimagentin namens Alicia Gris ist.
Über die Romangeschichte
Davon abgesehen liefert Das Labyrinth der Lichter auch die Auflösung aller Rätsel aus den voran gegangenen Bänden, die Verknüpfung aller losen Enden und Schicksale. (Was denn da noch alles offen stand, kann man zum Beispiel in meiner Rezension zum Gefangenen des Himmels im Abschnitt „Über lose Enden“ nachlesen.)
Doch vordergründig geht es zunächst einmal um einen Kriminalfall des Jahres 1959 in höchsten politischen Kreisen der spanischen Franco-Diktatur: Der Bildungsminister Mauricio Valls ist verschwunden. Die Polizei kommt jedoch auf offiziellem Wege nicht weiter. Sie zieht deshalb einen halbamtlichen Geheimdienst hinzu. Dadurch erhält Agentin Alicia Gris den Auftrag, den Fall zu lösen und Valls wiederzufinden. Sie wird dabei von Juan Manuel Vargas unterstützt, einem Hauptmann der Madrider Polizei.
Erste Ermittlungsergebnisse verlagern die Nachforschungen nach Barcelona, der Heimatstadt Alicias. Dort fügen Gris und Vargas ein Puzzlestück ans andere. Doch als sie sich einer konkreten Lösung des Falls nähern, werden die beiden urplötzlich von ihrem Auftrag abgezogen. Die Polizei habe nämlich den Verantwortlichen gefunden. Der habe das Geständnis abgelegt, Mauricio Valls ermordet zu haben. An dieser Stelle haben wir gerade einmal die Hälfte des Romans hinter uns gebracht: immerhin rund 700 Seiten in der deutschen Ausgabe, über die später noch zu sprechen sein wird.
Doch die Leserschaft weiß bereits, dass etwas an der offiziellen Aufklärung des Falles nicht stimmen kann. Denn immer wieder hatte Autor Ruiz bis dahin Passagen eingeschoben, in denen der verschwundene Minister als Gefangener in einer Zelle gefangen gehalten wurde. Zumindest bis hierhin war Valls also noch am Leben.
Der Geschichte zweiter Teil
Natürlich geben Alicia Gris und Juan Vargas nicht auf. Sie ermitteln auf eigene Faust weiter. Dass das jedoch nicht gut gehen kann, wird den Lesern schnell klar. Der Autor öffnet nun die Geschichte und zieht die Familie Sempere samt Fermín in die Geschehnisse hinein. Auch der Friedhof der Vergessenen Bücher spielt nun eine wichtige Rolle, auch wenn er zunächst zweckentfremdet wird. Er dient als Genesungsversteck für die schwer verletzte Alicia. Schließlich kommt es in den verwinkelten Gängen des Friedhofs auch zu einem ersten Showdown.
Apropos Showdown: Carlos Ruiz taucht die Handlung jetzt in Blut. Allein im zweiten Teil von Das Labyrinth der Lichter habe ich siebzehn Leichen mitgezählt. Nur vier davon starben eines natürlichen Todes. Nun ja, Romanfiguren sterben zu lassen, um auf ihrem Tod Erklärungen für Geschehnisse aufzubauen, ist seit jeher ein probates Stilmittel. Auf diesem Weg bietet auch Ruiz seiner Leserschaft einen unerwarteten Hintergrund der Verstrickungen an, die im dritten Romanband aufgebaut wurden. Der verschwundene Mauricio Valls erweist sich nämlich als skrupelloser Drahtzieher eines schrecklichen Verbrechens. Eines Verbrechens, das während des spanischen Bürgerkrieges begann und sich fast bis zum Ende des Jahrhunderts hinzog.
Historische Tatsache ist nämlich, dass in spanischen Geburtskliniken im großen Stil Neugeborene geraubt und an reiche kinderlose Paare verkauft wurden. An diesen lukrativen Geschäften waren Ärzte, Anwälte und vor allem die katholische Kirche beteiligt. In der ruizschen Geschichte hatte nun auch der fiktive Bildungsminister Valls seine Finger im Spiel.
Wer und warum alles sterben muss, bis diese Auflösung der Verstrickungen gelingt, werde ich selbstverständlich nicht verraten. Das sollen sich die Leser¦innen der gewaltigen Geschichte schon selbst erarbeiten.
Alicia Gris, die graue Vampirin
Warum der Autor im vierten Band eine völlig neue Protagonistin hinzuziehen musste, wird der Leserschaft rasch klar. Denn all die weit verstreuten losen Enden zu verknüpfen, wäre keiner der in den ersten drei Bänden aufgetretenen Figuren jemals gelungen. Schon gar nicht angesichts der räumlichen Ausweitung der Geschichte auf Madrid. Dazu brauchte es schon einen Geheimagenten mit besonderen Fähigkeiten und unbegrenzten Befugnissen; eine Art James Bond also.
Carlos Ruiz Zafón erschafft also zu diesem Zweck die mysteriöse Alicia Gris, deren Nachname auf deutsch „Grau“ bedeutet. Selbstverständlich taucht diese Frau nicht einfach so aus dem Nichts in der Erzählung auf. Vielmehr baut der Autor die Figur auf seine unnachahmliche Weise in die Handlung ein. Er bringt sie nämlich mit dem vorhandenen Personal in einen möglichst finsteren Zusammenhang.
Eine alte Geschichte
In diesem Fall bedient sich Ruiz seines Tausendsassas Fermín Romero de Torres als verbindendes Element. Denn gleich zu Beginn der Geschichte lässt er Fermín das kleine Mädchen Alicia während eines Bombenangriffs auf Barcelona aus einem zerbombten Haus retten. Tatsächlich gab es in der Realität einen solchen Luftangriff durch die italienische Luftwaffe. Das abgebildete Foto findet sich als Illustration auch in Das Labyrinth der Lichter. Die vier kleineren Rauchpilze in der oberen Bildhälfte markieren Bombeneinschläge im Altstadtviertel Raval. Genau dort, wo die Szene mit Alicia und Fermín spielt; nämlich in unmittelbarer Nachbarschaft des Friedhofs der Vergessenen Bücher.

(Italian Airforce, Public domain, via Wikimedia Commons)
Superagentin und Femme fatale
Alicia überlebt dieses Bombardement schwer verletzt und trägt eine dauer- und schmerzhafte Deformation der Hüfte davon. Schon damals retteten sie der Friedhof der Vergessenen Bücher und dessen Hüter, Isaac Monfort, vor dem Tod. Den körperlichen Schmerz bekämpft Alicia inzwischen mit Drogen und Alkohol. Sie wird dabei zu einer attraktiven, jedoch schwermütigen und distanziert wirkenden Frau, die für ihren Geheimpolizeichef alle Fälle löst, auch wenn sie noch so verfahren sein mochten.
Um seine Alicia noch passgenauer in sein Werk einbauen zu können, gibt ihr der Autor unverkennbar Züge der Chloé Permanyer, jener dunklen Fürstin der Vampire aus einer der Romangeschichten David Martíns aus Das Spiel des Engels. Jedenfalls trickst, schlägt und schießt sich Alicia Gris durch das Labyrinth der Lichter, bis letztlich alle Geheimnisse gelüftet und alle Verbrechen gesühnt sind.
Einordnung und Bewertung
Mit seinem Abschlussband hat Carlos Ruiz Zafón gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum ersten hat er einen Großteil der Mysterien aufgelöst, die in den drei Vorgängerromanen aufgebaut wurden. Ganz zufrieden bin ich allerdings nicht mit allen Details der Auflösung. Denn mindestens zweien seiner Figuren hat der Autor den Zauber geraubt, der ihnen zuvor anhaftete:
Andreas Corelli, der Höllenfürst aus Das Spiel des Engels und Der Fürst des Parnass, verschwindet spurlos und wird zur paranoiden Traumfigur David Martíns degradiert. Auch den mysteriösen Julián Carax, der damals im ersten Romanband Daniel Sempere und mit ihm die Leserschaft in Angst und Schrecken versetzte, entzaubert der Autor. Aus der entseelten Figur am Rande des Wahnsinns wird zuletzt ein väterlicher Ratgeber für seinen Namensvetter Julián Sempere, den Sohn von Daniel und Bea.
„Schreiben ist ein Beruf, den man erlernt, den aber niemand lehren kann.“
(Seite 1.341)
Solche Worte legt Ruiz seinem Carax in den Mund und lässt ihn dennoch als weisen Lehrmeister und Korrektor des jüngeren Julián abtreten.
Historische Komponente
Zum zweiten ist es dem Autor gelungen, mit seinem vierten Band ein umfassendes historisches Stimmungsbild abzuschließen. Die gesamte Serie begann chronologisch mit dem zweiten Roman im Dezember 1917 und endet nun mit einem kurzen Epilog am 9. August 1992, am Tag der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in Barcelona.
Die gesamte Geschichte zieht sich über acht Jahrzehnte hinweg. Nämlich genau über die Jahrzehnte, in denen der spanische Bürgerkrieg vorbereitet wurde, stattfand und letztlich in seinen Nachwehen die Franco-Diktatur mit all ihren Ungeheuerlichkeiten gebar. Ruiz Zafón ist es gelungen, mit seiner Romanreihe eine Epoche der spanischen Geschichte zu illustrieren, die mindestens dem deutschsprachigen Lesepublikum wohl kaum bekannt war.
Im Rückblick auf alle vier Romane ergibt sich ein faszinierender, wenn auch erschreckender Blick auf die Historie zwischen den Verliesen und Massengräbern des Montjuic. Auf die Geschichte skrupelloser und entmenschlichter Kriegsgewinnler und der schauerlichen Korruption der Nachkriegsjahre.
Familiensaga
Zum dritten hat Ruiz mit seinem Personal eine wunderbare Familiengeschichte geschrieben und abgeschlossen. Fünf Generationen der Semperes haben wir miterleben dürfen: vom Großvater Daniels bis zu dessen kleinen Enkelin Alicia, die nun als jüngste Repräsentantin der Semperes die Geheimnisse des Friedhofs der Vergessenen Bücher erkunden kann.
Mit den Semperes durften wir ein buntes Kaleidoskop von Begleitpersonal kennenlernen. Natürlich ist hier als erste die Figur des Fermín zu nennen. Er bringt mit seiner Entschlossenheit immer und immer wieder die Handlung voran. Und andererseits sorgt er dank all der Bonmots, die ihm der Autor in den Mund legt für Heiterkeit und Lesefreude. Wie Fermín der Leserschaft und den Semperes die Welt erklärt, das ist immer wieder eine Erleuchtung.
„Das Herz ist ein Teil der Eingeweide und pumpt Blut, keine Sonette. Mit etwas Glück kommt ein wenig von diesem Strom in den Kopf, aber größtenteils landet er im Bauch beziehungsweise, in Ihrem Fall, in den Schamteilen, die, wenn Sie nicht aufpassen, die Funktion der Hirnrinde übernehmen. Halten Sie die Hodenmasse fern vom Ruder, und Sie werden den Hafen erreichen. Benehmen Sie sich wie ein Narr, und das Leben wird an Ihnen vorüberziehen, ohne dass Sie etwas Nützliches getan haben.“
(Seite 1.302)
Aber auch all die anderen Romanfiguren aus dem familiären und räumlichen Umfeld der Buchhändlerfamilie haben wir über die vier Folgen hinweg liebgewonnen. Gleich, ob es sich um schwatzsüchtige Nachbarinnen, schwule Uhrmacher oder schwadronierende Literaten handelt.
Letztlich haben wir uns sogar mit einer ruizschen Besessenheit ausgesöhnt. Nach seiner Darstellung scheint die Mittelmeermetropole Barcelona niemals von mediterranem Klima geschmeichelt sondern stets von Kälte, Regen und sogar Schnee heimgesucht zu werden. Obwohl wir – zumindest zur Zeit der Romanhandlungen – noch weit vom Einbruch einer Eiszeit in Katalonien entfernt waren.
Erfolgsrezepte
Ein weiteres Mal ist es Carlos Ruiz Zafón gelungen, mit seinem Sprachwitz und seiner Formulierungskunst eine Geschichte zu erschaffen, die seine Leserschaft in den Bann schlägt. Einen „Roman mit großer Sogkraft“ nennt Mario Scalla von hr2-Kultur Das Labyrinth der Lichter. Diese Sogkraft ist allerdings auch dringend nötig. Denn die Erzählung ist kleinteilig, verwinkelt und manchmal nicht ganz einfach zu verfolgen.
Außerdem strotzt der Text nur so von mehr oder weniger versteckten Hinweisen auf Personen und Begebenheiten in den Vorgängerromanen. Zwar lässt der Autor seinen Julián Carax auf Seite 1.274 des Buches sagen: „Eine Geschichte hat weder Anfang noch Ende, nur Eingangstüren.“ Damit meint Ruiz, dass man die einzelnen Bücher des Zyklus in jeder beliebigen Reihenfolge lesen könne. Doch da muss ich ihm energisch widersprechen. Denn ohne die ersten drei Romane aufmerksam gelesen zu haben, wird man nämlich einen erklecklichen Teil der Passagen in Das Labyrinth der Lichter nicht verstehen können.
Ein weiteres Rezept, mit dem Ruiz bereits in vorausgegangenen Erzählungen punkten konnte, ist das Prinzip der Rekursion. Damit gemeint ist das Einbinden von Romanen im Roman, die sich auf sich selbst beziehen. Immer wieder tauchen im Text Passagen auf, die angeblich aus Titeln stammen, die zwar Carlos Ruiz selbst verfasst hat, nun aber anderen Autoren zugeschrieben werden; nämlich Personen aus der Romanhandlung selbst.
So wird bereits auf Seite 36 als Verfasser von Das Labyrinth der Lichter der Schriftsteller Julián Carax genannt. Und ab Seite 1.310 treibt Ruiz das Prinzip auf die Spitze, indem er seinen gesamten Zyklus den beiden Juliáns andichtet. Sempere junior und Carax planen dort gemeinsam alle vier Romane um den Friedhof der Vergessenen Bücher. Ganz so als habe der eigentliche Autor, Carlos Ruiz Zafón, keine einzige Romanzeile je selbst zu Papier gebracht. – Ein vergnügliches Versteckspiel, wie immer; auch wenn sich der mystifizierende Effekt langsam abnutzt.
Gestalterische Randbemerkungen
Dieser vierte und letzte Romanband aus der Serie um den Friedhof der Vergessenen Bücher nimmt auch in Hinblick auf Aspekte der Gestaltung eine herausragende Rolle ein. Denn bereits im Vorwort präsentiert man uns ein eigenes Logo für diesen Bücherfriedhof: eine stilisierte Wendeltreppe, die in die Tiefe zu führen scheint.
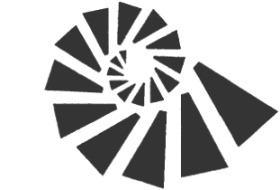
„Virgilio nahm es entgegen und knipste die Taschenlampe an. Sowie er die Gravur der Wendeltreppe auf dem vorderen Deckel erblickte, starrte er Alicia an.
»Aber haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, was das ist?«“
(Seite 271)
Mich persönlich hat dieses Logo spontan an Fotoaufnahmen der schier endlosen Wendeltreppen in den Türmen der Kathedrale Sagrada Familia Barcelonas erinnert.
Umschlagfotografie
Wenn wir schon bei fotografisch-gestalterischen Mitteln sind, dann weise ich auch gleich noch auf den Ursprung der Fotografie auf dem Buchumschlag hin. Die stammt nämlich ursprünglich von Gabriel Casals aus dem Jahr 1932. Sie ist im katalanischen Nationalarchiv zu finden und trägt den Titel Día del libro | Tag des Buches. Auch diese bibliophile Kleinigkeit ist einer der liebevollen Zirkelschlüsse, die den Zyklus um den Friedhof der Vergessenen Bücher auszeichnet.
Format der deutschen Ausgabe
Bereits das spanische Original hat einen Umfang von über 900 Seiten. Der Fischer Verlag aber hat in seiner deutschsprachigen Ausgabe noch einen draufgesetzt. Er hat nämlich dem ohnehin monumentalen Werk eine besondere Note verpasst. Das Format wurde reduziert auf Postkartengröße, gedruckt in kleiner Schrift auf Dünndruckpapier. Dadurch erreicht das „Büchlein“ eine Textseitenzahl von über 1.350 und gleicht einem dicken Kirchengesangsbuch. Amen.
~
Wem diese Buchbesprechung gefallen hat, wird sich vielleicht für das Autorenprofil von Carlos Ruiz Zafón interessieren, das ich als Nachruf zu seinem Tod im Juni 2020 zusammengestellt habe. Darin sind auch meine Rezensionen seiner anderen Romane des Zyklus verlinkt.
Fazit:
Das Labyrinth der Lichter ist nun der krönende Abschluss einer Romanreihe, die sich fast über das komplette zwanzigste Jahrhundert im katalanischen Barcelona erstreckt. Das Schicksal der Familie Sempere findet seinen Abschluss. Gleichzeitig rechnet Carlos Ruiz Zafón mit den spanischen Jahrzehnten in der Folge des Bürgerkriegs ab. Zweifellos ist dieser vierte Roman im Umfeld des Friedhofs der Vergessenen Bücher ein Leckerbissen für alle Fans der Semperes und Fermín Romeros de Torres. Wahrscheinlich aber werden die Freunde der magischen, mysteriösen Anteile der Vorgängerbände nicht ganz so begeistert von diesem letzten Teil sein.
Mit der Schlussbewertung in Form meiner Sternevergabe habe ich mich diesmal sehr, sehr schwer getan. Denn als Einzelroman käme Das Labyrinth der Lichter wohl nur mit Müh und Not, mit Ach und Krach auf drei Sterne von den fünf möglichen. Da mich jedoch die kunstvolle Verwebung der Erzählung mit den Vorgeschichten in ihren Bann geschlagen hat und weil ich letztlich meinem Lesespaß Tribut zollen musste, sind es dann doch – wenn auch knapp – vier Sterne geworden.
Carlos Ruiz Zafón:
El laberinto de los espíritus | Das Labyrinth der Lichter,
🇪🇸 Planeta, 2016
🇩🇪 Fischer Verlag, 2017
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)
Fußnoten:
*) Quelle: Interview von Carlos Ruiz Zafón anlässlich der Veröffentlichung von El laberinto de los espiritús durch Andreu Buenafuente, LATE MOTIV, im November 2016 🇪🇸