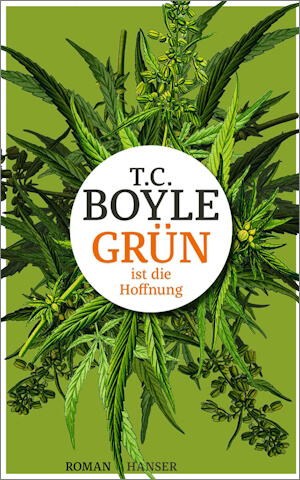
Seinen zweiten Roman mit dem Titel Grün ist die Hoffnung hat T. C. Boyle drei Jahre nach seinem Erstling Wassermusik veröffentlicht. Im ersten Buch steckt immer die ganze Seele drin, heißt es. Das zweite Buch aber gilt als schwierig. Es ist Gradmesser dafür, ob aus dem Debütanten tatsächlich ein Schriftsteller wird, also jemand, der die Erwartungen nach dem Einstandswerk auch erfüllen kann. Nun wissen wir ja alle, dass es Boyle mit inzwischen neunzehn Romanen und einigen Erzählbänden zwischendurch längst geschafft hat. Trotzdem ist es spannend, das zweite Werk unvoreingenommen zu lesen. Vorweggenommen sei: Grün ist die Hoffnung ist völlig anders geraten als Wassermusik. Mit Biografie oder Abenteuern auf fremden Kontinenten hat die Geschichte nichts zu tun. Dafür aber legt sie den Grundstein für künftige boylesche Romanszenarien. Denn sie wirft die Figuren – wie in so vielen späteren Boyle-Romanen auch – in eine Konfrontation mit der Gewalt der Natur hinein und stellt menschliche Qualitäten in Frage. Außerdem trägt sie sich in dem US-Bundesstaat zu, in dem der Autor selbst zu Hause ist.
Boyle schickt seinen Erzähler Felix Nasmyth von San Francisco gut zweihundert Kilometer in den Norden ins Mendocino County, in die Wildnis nördlich von Willits, einem Kaff in Nordkalifornien. Was treibt Felix in diese gottverlassene Gegend? Die Aussicht auf ein paar hunderttausend Dollar. Ein Frisco-Freund, der umtriebige Investor Herbert Vogelsang, hat dort nämlich abgelegenes Terrain aufgekauft und Felix davon überzeugt, in der einsamen Gegend eine Marihuanaplantage anzulegen. Nur für einen Sommer lang. Mit der Aussicht auf einen lukrativen Deal: 1,5 Millionen Dollar Ertrag, die sich der Geldgeber Vogelsang, Felix als Verantwortlicher vor Ort und Boyd Dowst, der botanische Ratgeber der Pflanzung, redlich teilen werden.
Zu den Geschehnissen
Muss ich überhaupt erwähnen, dass die Unternehmung nicht ohne Probleme abläuft? – Felix landet mit zwei Kumpanen, Phil und Gesh, die er erst noch aus dem Knast befreien muss, indem er ein paar Dollar Kaution bezahlt, im Niemandsland. Die Unterkunft, die sie vorfinden, befindet sich in einem grauenhaften Verwahrlosungszustand. Boyle liebt es ja, seine Romanfiguren in unerträglichen (Über-) Lebensumständen stranden zu lassen. Siehe zum Beispiel auch in San Miguel oder Wenn das Schlachten vorbei ist.
Die drei kämpfen auf von vornherein verlorenem Posten: gegen die rustikalen Nachbarn und misstrauische Bewohner der Gegend; gegen Wetterunbillen, Technikprobleme, Tierfraß und die Fehlkalkulation durch den angeblichen Fachmann; gegen Behörden und Polizei (sehr toll inszeniert durch die Figur des größenwahnsinnigen, gewalttätigen Officers John Jerpbak!); vor allem aber gegen ihre eigene Unfähigkeit, sich an Pläne zu halten oder wenigstens ein halbes Jahr lang alle egoistischen Bedürfnisse zu unterdrücken, einfach zu arbeiten und sich ansonsten unsichtbar zu machen.
Es ist der Faktor „Mensch“, der versagt. Botaniker Dowst und Geldgeber Vogelsang ziehen sich aus dem Projekt zurück. Felix, Gesh und Phil bereiten dem „Sommerlager“ in einem furiosen Finale ein Ende, versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Viel ist das nicht mehr, denn der avisierte Millionengewinn ist zuletzt auf ein paar tausend Dollar für jeden zusammengeschmolzen. Wutentbrannt steuert Felix auf einen Showdown mit Vogelsang zu.
Einschätzung
Boyles Erzählung schildert den ewigen Kampf von stark gegen schwach, den nur in der Bibel der kleine David für sich entscheiden konnte. Im wirklichen Leben gewinnen immer die Starken. Der Mensch hat nicht die geringste Chance gegen die Gewalt der Natur, da hilft kein Hoffen, keine Technologie. Und auch im Zwischenmenschlichen unterliegt der Kleine dem Großen: Vogelsang zieht die Strippen, hat immer noch einen Plan B in der Tasche und ist letztlich der einzige Profiteur der Unternehmung im Mendocino County. Seine Handlanger gehen leer aus und können von Glück sagen, dass sie das Sommerlager überhaupt überlebt haben.
Die zweite Geschichte
Hinter der vordergründigen Handlung über Mensch gegen Natur, über Gewinner gegen Verlierer spinnt der Autor die Entwicklungsgeschichte von Felix, dem „Glücklichen“. Der Erzähler der Geschichte war bis dahin einer, der stets vor Konsequenz und Verantwortung zurückschreckte. Als Schüler scheiterte er an der Aufnahme ins Baseballteam, als Student brach er vor dem Examen ab, als Ehemann verließ er seine Frau – in jedem Fall ohne Not, aus purer Versagensangst. Felix hat nie etwas zu Ende gebracht und auch das Unternehmen mit der Marihuanaplantage schmeißt er um ein Haar hin, als ernste Schwierigkeiten auftauchen.
Doch diesmal hält Felix durch. Bis zum bitteren Ende. Und er wächst an der Herausforderung. Ganz zuletzt steht da ja auch noch ein Silberstreif namens Petra Pandazopolos am Horizont. Felix hatte die junge Frau, die in Willits ihre Töpfereiwaren an Touristen verkaufte, erst zur Mitte der Geschichte kennengelernt, die beiden wurden später ein Paar.
Dann rangierte ich rückwärts aus Vogelsangs Tor, fuhr die gewundene Zufahrt hinunter, vorbei an gespenstisch gestreiften Eukalyptusbäumen, und wandte mich nach Norden, nach Willits. Vor mir lagen ein langer, regnerischer Winter und viel Zeit, um nachzudenken, etwa Neues anzufangen und vielleicht sogar – wenn alles gut ging – einen winzigen Samen zu pflanzen.
(Schlusssatz des Romans, Seite 383)
Über den Erzählfluss
Boyle lässt seinen Erzähler Felix ohne jeden chronologischen Versatz und ohne nennenswerte Einschübe aus der Vergangenheit berichten. Und auch wenn er den Roman in vier Teile separiert, so bleibt die Geschichte doch eine Aneinanderreihung von Ereignissen. Felix spricht die Leserschaft immer wieder direkt an: „Ich werde Ihnen jetzt mal was erzählen über …“
Überhaupt, dieser Felix hat eine sehr direkte, joviale Art sich zu erklären. Er geht auch nicht sparsam mit seinen Gefühlen oder mit heftiger Kritik an sich selbst um. Sehr gerne setzt er groteske Vergleiche ein, die an Formulierungen aus Jerry-Cotton-Romanheftchen erinnern und die den Lesefluss auflockern. Da gibt es „Espressomaschinen, so groß wie Kirchenorgeln“, Felix „trank acht Tassen nach Metall und Tod schmeckenden Kaffee“, die Musik ist „wie ein Überfall, laut genug, um Gase zu ionisieren, Gehöre zu zerstören und Hirnhäute zu zerfetzen“. Einer der Jungs „umklammerte eine Bloody Mary, als wäre es der Hebel für den Schleudersitz eines brennenden Düsenjägers“. Jemand sieht aus, „als würde man ihm eine Deutung von Finnegan’s Wake abverlangen, ihn dabei aber zugleich einer Elektroschocktherapie unterziehen“. Die Augen eines anderen „waren zu groß und quollen unter den Lidern hervor wie Bierbäuche unter eingelaufenen T-Shirts“. Und Felix „war erfüllt von Trauer, randvoll wie eine Karaffe mit saurem Wein“.
Ein weiteres Merkmal des boyleschen Erzählflusses, das er schon damals, in seinem zweiten Roman, gezielt einsetzt und das seither immer wieder zu seinen auffälligen Stilmitteln gehört, ist das Abbrechen kurz vor der Apokalypse: Die Handlung steuert auf eine Katastrophe zu, doch direkt vor deren Eintritt endet das Kapitel. Das Folgekapitel setzt danach etwas später ein und berichtet – sozusagen mit zeitlichem Abstand – rückblickend und distanziert über die übersprungenen Ereignisse. Dieses Ausdrucksmittel gefällt mir ungemein.
Cameo-Auftritte
In vielen seiner Geschichten und erstmals in diesem zweiten seiner Romane verschafft T. C. Boyle seiner eigenen Person kurze, versteckte Auftritte. Die sind weit davon erntfernt, als autobiografische Elemente herhalten zu können. Aber sie sind doch auffällig genug, um der Leserschaft ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern. Zwei kurze Beispiele aus dieser Geschichte: Ein Hinweis auf die gemeinsame Vergangenheit von Felix und Phil in Lake Peekskill (Seite 78), wo Boyle selbst aufwuchs. Oder auf Details zum Studiengang in Englischer Literatur des 19. Jahrhunderts (Seite 11), den Felix ebenso wie zuvor schon Boyle absolvierte.
~
Wer diese Rezension gern gelesen hat, interessiert sich eventuell auch für das Autorenprofil, das ich zu T. C. Boyle angelegt habe und in dem auch alle anderen Buchbesprechungen von Boyle-Romanen auf dieser Website zu finden sind.
Fazit:
Grün ist die Hoffnung ist eine leichtfüßig dahinlaufende Geschichte, die gespickt ist mit kleinen und größeren Katastrophen, aber eben immer wieder in die Hoffnung mündet, es könne sich doch noch alles zum Guten wenden. Bis zum Schluss. Darüber hinaus könnte man sie auch als alternative Autobiografie lesen: Wie hätte alles kommen können, wenn Boyle nicht irgendwann den Absprung geschafft hätte und nach seinen wilden Jahren nicht zum dem geworden wäre, der er heute ist? So bilde ich mir das wenigsten ein.
Der Roman reicht nicht an die Meisterwerke des Schriftstellers heran, die ich mit vier oder fünf Wertungssternen versehen habe. Aber richtig dicke drei von den möglichen fünf Sternen hat die Geschichte allemal verdient. Im besten Sinne bizarre Unterhaltungslektüre mit jeder Menge skurrilem Personal, die weit, sehr weit über das Niveau von Trivialliteratur hinausgeht.
T. C. Boyle: Budding Prospetcs | Grün ist die Hoffnung
🇺🇸 Viking Press, 1984

* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)




