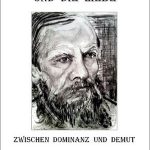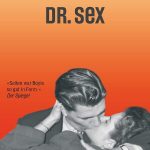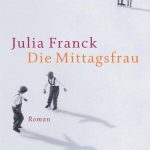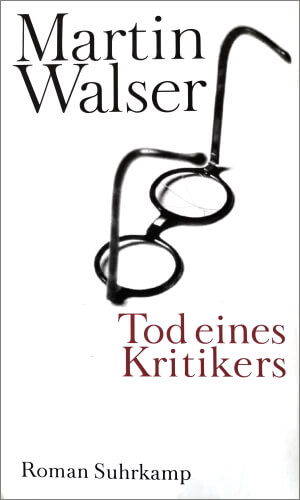
Nach der Ankündigung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sie verweigere dem Schriftsteller Martin Walser den geplanten Vorabdruck des Buches, da es sich um einen antisemitischen Roman handle, hat Tod eines Kritikers den Literaturskandal schlechthin im Frühjahr 2002 ausgelöst. Dem Verkauf des Buches hat die harsche Kritik fraglos gut getan, den Ruf des „Opfers“ Marcel Reich-Ranicki hat sie zementiert.
Aus der Warte eines lange Zeit anonym bleibenden Michael Landolf schreibt Martin Walser über die Geschehnisse nach einer literaturkritischen Fernsehsendung namens Sprechstunde. In der Sendung zerfetzte Kritikerpapst André Ehrl-König das neuste Werk des Schriftstellers Hans Lach, Mädchen ohne Zehennägel, in der Luft. Zur Feierstunde nach der Sendung in der Villa eines bekannten Verlegers verschafft sich Lach ungeladen Zugang und bedroht Ehrl-König: „Die Zeit des Hinnehmens ist vorbei. Sehen Sie sich vor, Herr Ehrl-König. Ab heute nacht Null Uhr wird zurückgeschlagen.“
Nach der Feier verschwindet der Kritikerpapst, nur sein mit Blut verschmierter Pullover wird gefunden. Lach gerät unter Mordverdacht, wird verhaftet. Erst gegen Ende des Romans taucht Ehrl-König wohlbehalten wieder auf. Er hatte einige Zeit bei einer seiner Bewunderinnen verbracht, ohne sich zu melden.
Worum es geht
Die Buchseiten zwischen dem Verschwinden und der Auferstehung des Literaturpapstes füllt der Autor Walser mit den Nachforschungen Landolfs. Dieser glaubt nicht an eine Tat Hans Lachs. Er versucht, durch Gespräche mit Personen des Literaturbetriebs, Freunden und Feinden von Ehrl-König und Lach, dessen Unschuld nachzuweisen. Erst nach der Auflösung des vermeintlichen Mordfalles outet sich Michael Landolf als Hans Lach selbst.
Michael Landolf, Hans Lach, Martin Walser – alle drei sind eine Person. Dass Walser mit der Figur des Kritikerpapstes Ehrl-König tatsächlich Marcel Reich-Ranicki meint, ist jedem sofort klar, der ein paar Male Das Literarische Quartett im Fernsehen verfolgt hat. Unverhohlen beschreibt der Autor die Person Ehrl-König, die sich benimmt wie der reale Reich-Ranicki, die „spericht“ wie Reich-Ranicki und argumentiert wie Reich-Ranicki.
Auch historische Parallelen festigen die Zusammenhänge zwischen Identitäten des Romans und der realen Literaturszene Deutschlands. So wie im Buch Ehrl-König den guten Roman von Philip Roth dem schlechten von Lach gegenüberstellt, verfuhr in der Realität einst Reich-Ranicki mit den Werken von Martin Walser und eben des gleichen Philip Roth. Wahrscheinlich wird auch der Rest der handelnden Romanfiguren sein Spiegelbild in der Realität finden. Allein, ich kann dies nicht beurteilen, da ich in keiner Weise sattelfester Kenner der deutschen Literaturszene bin.
Erfolgsrezept
Was bleibt zu kommentieren, wenn die personellen Zuordnungen zwischen Realität und Roman klar sind?
Zum einen muss gesagt werden, dass Reich-Ranicki in der Geschichte sehr schlecht wegkommt. Walser versteht es, einerseits Respekt und Achtung vor der Figur des Kritikers in den Vordergrund zu stellen. Auf der anderen Seite lässt er jedoch glasklar durchblicken, wie verachtenswert, wie abscheulich der Mann tatsächlich ist. Sein Habitus, seine Neigungen, sein gesamtes Wesen werden analysiert und vernichtend beurteilt. Übrig bleibt ein hoffnungsloser Egomane, ein sich ständig selbst zelebrierender Popanz, ein Macho ohne Gefühl für Realität, ohne Gnade für seine gesamte Umwelt. Zwar impotent, aber dennoch sexuell gierig mit angedeuteter pädophiler Tendenz. Schlichtweg: ein Scheusal.
Bei seiner Beurteilung generiert Martin Walser ein Bild der Objektivität, indem er den Ich-Erzähler kaum werten lässt. Vielmehr schildert er vermeintliche Tatsachen und lässt darüber hinaus die anderen handelnden Personen ihre Urteile über Ehrl-König alias Reich-Ranicki abgeben. Ein Meisterwerk der spitzen Feder, um nicht zu sagen: der perfidesten Verleumdungskunst!
Ein Rundumschlag
Der Vollständigkeit halber sei noch hinzugefügt, dass die gesamte Literaturszene Deutschlands in dem Roman nicht viel besser beurteilt wird als Reich-Ranicki. Sozusagen als Rahmenhandlung konstruiert Walser ein Gerüst aus Eitelkeiten, gegenseitigen Anschuldigungen und Verachtung. Das ist der zentrale Grundtenor des Werkes: Der Roman handelt von der Machtausübung und den Ränkespielen des Literaturbetriebes in den Zeiten des Fernsehens.
Auch sich selbst spart Walser nicht ganz aus. Selbst wenn die höchste Form der Selbstkritik darin besteht, Hans Lach zwar als sympathisch, dabei aber als unselbständig und entscheidungsschwach darzustellen. Aber gerade durch die lässlichen Schwächen, die labile Unschuld des Kontrahenten von Ehrl-König, gewinnen dessen Konturen noch an Bestialität.
Ist der Roman antisemitisch?
Der Jude Moshe Zimmermann formulierte eine recht gute Diskussionsgrundlage zur Beantwortung dieser Frage: „Wer nicht von einer Person, sondern von einem Vertreter der Juden spricht, der setzt sich dem Vorwurf des Antisemitismus aus.“
Beim Lesen des Romans habe ich versucht, mir diesen Satz ständig vor Augen zu halten. Nur deshalb ist es mir gelungen, die Textpassagen ausfindig zu machen, die verdächtig sein könnten. Einem weniger vorbelasteten Leser wären solche Stellen wohl kaum aufgefallen.
Die Vermutung, Walser schreibe über einen „Vertreter der Juden“, nicht bloß über den Menschen Reich-Ranicki wird vor allen Dingen durch die bereits zu Anfang zitierte Passage, die Drohung Lachs gegenüber dem Kritiker als eine verbale Hitler-Variation, gestützt.
„Als Adolf Hitler seine Kriegserklärung gegen Polen formulierte, war dies auch eine Kriegserklärung an den damals in Polen lebenden Marcel Reich und seine Familie. Nicht viele europäische Juden haben diesen Satz von Adolf Hitler überlebt.“
So formulierte FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher seine Kritik am Walser-Roman. Er wolle keinen Roman drucken, der den Judenmord fiktiv nachhole. Er denke nicht daran, der These, der ewige Jude sei unverletzlich, ein Forum zu bieten.
Einordnung
Wenn ich aber auf den Gesamteindruck des Romans zurückdenke, kann ich nicht anders als festzuhalten, dass ich nie den Eindruck hatte, Antisemitisches zu lesen. Schirrmachers Gedankengänge kann ich nicht nachvollziehen. Der Tod eines Kritikers ist keine Mordfantasie an einem Überlebenden des Holocaust. – Aber die Gedanken sind frei. Das ist wohl wahr, und Gedanken eines Schriftstellers sind doppelt frei.
Zumindest aber handelt es sich bei Martin Walsers Roman um eine beklemmende Hasstirade gegen eine Person des öffentlichen Lebens; gegen einen, der sich Walser zum Feind gemacht hat. Vielleicht ist diese Tatsache der eigentliche Grund dafür, dass die FAZ einen Vorabdruck ablehnte? Wollte sie sich nicht zum Sprachrohr eines persönlichen Rachefeldzuges machen lassen? Einen solchen Gedankengang könnte ich nachvollziehen. Lieferten dann aber die zeitgleich verlaufenden antisemitischen Äußerungen von Karsli und Möllemann nur den Vorwand, sich von Walsers Werk zu distanzieren?
Fazit:
Wer Marcel Reich-Ranicki kennt, wer den einstmaligen deutschen Literaturpapst möglicherweise nicht besonders gemocht hat, der wird seine Freude an Tod eines Kritikers haben. Denn selbst wenn man einschränkend feststellt, dass Walsers Beschreibungen überspitzt, gemein und extrem aggressiv sind, auch wenn man einräumt, dass die Persönlichkeitsrechte nicht nur Reich-Ranickis verletzt werden, so muss trotzdem festgehalten werden, dass Walsers Schreibe brillant ist und einfach messerscharf schneidet.
Rein handwerklich gesehen, hätte Walser dafür locker vier Sterne verdient. Dass ich dann letztlich „nur“ drei von fünf möglichen vergebe, liegt lediglich an einem gewissen Unbehagen angesichts dieser auf Papier ausgetragenen persönlichen Fehde.
Martin Walser: Tod eines Kritikers
Suhrkamp Verlag, 2002
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)