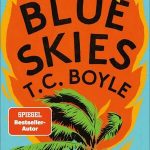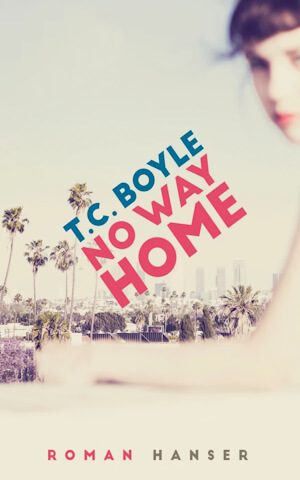
Am 16. September 2025 erschien der zwanzigste Roman des US-Romanciers T. C. Boyle mit dem Titel No Way Home. Die Besonderheit: Die deutsche Übersetzung ging ein halbes Jahr vor dem englischsprachigen Original in den Verkauf – ein Geschenk des Autors an seine große deutsche Fangemeinde. Ebenfalls neu: Von Kalifornien geht es diesmal nach Osten, mitten hinein in die Wüste. Nämlich in die Kleinstadt Boulder City, ein paar Kilometer südöstlich von Las Vegas. Dort spielt sich die Dreiecksbeziehung zwischen Terry, einem Arzt aus Los Angeles, der übergriffigen Bethany und deren eifersüchtigem Ex Jesse ab.
In den drei Romanvorgängern behandelte Boyle die Themen Klimawandel (Blue Skies), Evolution (Sprich mit mir) und eine Biografie des LSD-Papstes der Sechziger, Timothy Learys (Das Licht). In seinem neusten Werk stürzt er nun sein Personal und seine Leserschaft in menschliche Abgründe.
Worum es geht
Die faktische Handlung der Romangeschichte ist in wenigen Sätzen nacherzählt. Dr. Terrence Tully (31) arbeitet als angehender Internist in einem Krankenhaus in Los Angeles. Als seine alte Mutter Katie verstirbt, muss sich Terry nach Boulder City in Nevada begeben, viereinhalb Autostunden ins Landesinnere der USA, um die Nachlassangelegenheiten zu regeln. Dort kennt der junge Mann niemanden, lernt jedoch zufällig die derzeit wohnungslose Bethany Begany (24) kennen.
Nach einem One-Night-Stand im verlassenen Haus von Terrys Mutter bietet sich Bethany – nicht uneigennützig als Haushüterin an. Und obwohl Terry ablehnt und nach L.A. zurückfährt, nistet sich die junge Frau dennoch im Haus seiner verstorbenen Mutter ein. Damit nicht genug, die junge Frau bewirtet und beherbergt dort auch noch heimlich abgerissene Freunde aus dem Umfeld ihres Ex-Freundes Jesse Seeger (24).
Konfrontationen
Terry ist wütend angesichts des übergriffigen Verhaltens von Bethany. Doch statt die junge Frau wie geplant aus dem Haus zu werfen, lässt er sich von ihr um den Finger wickeln. Sie schafft es immer wieder, Terrys Zorn verrauchen zu lassen und in Begehren zu verwandeln. Außerdem ist da auch noch der alte Hund der verstorbenen Mutter, um den sich Bethany rührend kümmert und den Terry unmöglich in sein enges Appartment in L.A. mitnehmen kann. Also bleibt doch alles, wie es ist; Terry pendelt zwischen Küste und Wüste.
Bethany ihrerseits hatte sich zwar von ihrem Freund Jesse losgesagt, den sie seit der Schulzeit kennt. Doch dessen schamlosem, machohaftem Besitzanspruchsdenken hat sie nur wenig entgegenzusetzen. Obwohl sie eigentlich von einer Zukunft mit dem Arzt Terry träumt, erliegt Bethany immer wieder Jesses Übergriffen – erstaunlicherweise oft nicht ganz unfreiwillig.
Da bleibt es folgerichtig nicht aus, dass die beiden Männer heftig aneinander geraten. Mit körperlicher Gewalt, mit dem Willen zu zerstören, jeder mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Und wie reagiert Bethany auf die sich zuspitzenden Gefechte? Sie bleibt bis zum Ende neutral, gefangen in einem irrationalen, ambivalenten Zustand der Unschlüssigkeit und Passivität.
Psychogramme des Personals
Alle drei Hauptfiguren der Romangeschichte besitzen einen gleichen Wesenszug: Sie sind nicht in der Lage, überlegte Entscheidungen zu treffen und diese konsequent bis zur Zielerreichung zu verfolgen. Bethany, Jesse und Terrence stolpern immer wieder über ihre eigenen inneren Widersprüche und Schwächen.
Der Antiheld und Arzt Terry ist überfordert von den Herausforderungen seines Berufs und seiner Unfähigkeit, sich nicht von den Eindrücken des Moments überrollen zu lassen. Er ist ein willensschwacher Getriebener, der sich sehenden Auges von den Menschen in seiner Umgebung ausnutzen lässt. Die Femme fatale Bethany ist zwar lebenstauglicher als Terry. Und sie zeigt durchaus berechnende Wesenzüge. Aber trotzdem handelt sie immer wieder inkonsequent und planlos.
„Ihm kam der Gedanke, sie könnte labil sein, unzuverlässig, ein Katastrophengebiet, aber andererseits brauchten schöne Frauen nicht belastbar oder auch nur liebenswert sein – sie brauchten lediglich ihre physische Präsenz, um ihre Gene weiterzugeben und durch alle Generationen der Menschheit zu segeln.“
(Seite 68)
Der Desperado Jesse
Die spannendste Figur der Geschichte ist aus meiner Sicht Jesse. Der verdient zwar sein Geld respektabel als Junglehrer an einer Highschool. Doch im Kontrast dazu stehen seine Freizeitaktivitäten. Mit seinem Kumpel Thomas düst er auf dem Motorrad durch die Gegend und macht die Kneipen unsicher. Jesse ist ein gutaussehender, wenn auch ordinärer Haudrauf, der nichts anbrennen lässt und sich ausnahmslos stets selbst im Mittelpunkt und im Recht sieht. Andererseits zeigt er zumindest ansatzweise schriftstellerische Ambitionen. Der junge Mann hat – Mitte zwanzig – ganz offensichtlich seine Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen. Und er handelt ausnahmslos impulskontrollgestört, unberechenbar und egoistisch selbstgerecht. Man fragt sich, wann Jesse einmal gegen eine Wand fahren wird, die nicht nachgibt.
Struktur der Geschichte
T. C. Boyle erzählt seine Geschichte in sieben Teilen, jeweils im Wechsel aus der Perspektive von Terrence, Bethany und Jesse. Die Teile sind römisch von I. bis VII. durchnummeriert, mit einem der drei Protagonistennamen untertitelt und bestehen jeweils aus mehreren Kapiteln. Teil I. ist mit 24 Kapiteln am längsten, der letzte Teil mit nur 2 Kapiteln am kürzesten.
Alle sieben persönlichen Berichte der drei Hauptfiguren sind in der dritten Person formuliert. Dennoch enthalten sie sehr subjektive Beobachtungen und Gedanken der Berichterstatter. Die Spannung erhält Boyle über insgesamt fast 400 Buchseiten dadurch aufrecht, indem er die einzelnen Berichte gerne mit Cliffhangern enden lässt.
Die Folgekapitel setzten dann nicht immer in dem Moment ein, wo der Text zuvor endete. Manche Folgekapitel überdecken sich chronologisch mit der Vorgeschichte. Andere setzen mit einigem zeitlichen Abstand ein und kehren erst später an den Endpunkt des Vorberichts zurück. Das macht die Lektüre durchweg spannend und fordert die Konzentration der Leserschaft.
Gesellschaftskritik
Im Hintergrund der Dreiecksgeschichte lässt der Autor, so wie man es von ihm kennt, die US-amerikanische Gegenwart zirkulieren. In Los Angeles zieht eine Armada von Verlierern durch die Behandlungsräume des Krankenhauses, lauter „Irre in einer endlosen Parade von Irren“ (Seite 93): eine volltrunkene Autofahrerin, die sich beim Unfall skalpiert hat; ein fettleibiger Hispano, der trotz intensiver Herzmassage einem Infarkt erliegt; eine obdachlose und immer wieder lädierte Stammgästin, die in einem Hundezwinger übernachtet; oder psychiatrische Fälle mit diversen Leiden:
„Er hieß Herbert Lodgepole, nannte sich aber ‚Bouncy Balls‘, war zweiundvierzig, hatte, soweit bekannt, keine Angehörigen und schmierte sich seit einem Monat mit seinen eigenen Exkrementen ein. […] ‚Nennen Sie mich Bouncy‘, sagte er. ‚Oder einfach Shitman.'“
(Seite 86 f.)
Hinzu kommen Ermittlungsbeamte und Streifenpolizisten, die überfordert sind; Rednecks, die von Überlegenheitsfantasien besoffen und zweifellos im MAGA-Umfeld zu verorten sind; Frauen, die sich behinderte Ehemänner angeln, um irgendwann als deren Witwen im Geld zu schwimmen.
All diese Randfiguren wabern wie Geister durch den Hintergrund der Romangeschichte. Wenn man den Text nicht wirklich aufmerksam liest, verschwinden sie ebenso schnell, wie sie aufgetaucht sind. Aber sie alle sind Teil einer US-Gesellschaft, mit der etwas nicht stimmt.
Rezeption und Bewertung
In der professionellen Rezensentenszene wird No Way Home durchwachsen besprochen. Peter Helling (NDR kultur) bemängelt „veraltete Klischees“ und entdeckt „unglaubwürdige Amerikabilder von gestern“. In der ZEIT spricht Daniel Haas recht vorsichtig von fehlenden Kürzungen und mangelhaftem Lektorat. Irene Binal von der Neuen Züricher Zeitung fehlt „das Außergewöhnliche in der völlig humorbefreiten Konstellation“. Und Leon Frei vergleicht in der Süddeutschen Zeitung den neuen Boyle mit den Romanen von Thomas Mann, denn das Ergebnis bleibe ambivalent, die Konflikte zwischen Rationalität und Emotionalität unaufgelöst. Einen „ganz eigenen Sog“ attestiert schließlich Judith von Sternburg (Frankfurter Rundschau) und zeigt sich zumindest einigermaßen beeindruckt: So spannend und rauschhaft es hier manchmal zugehe, überwiege doch der Eindruck von „Lethargie, Passivität“ und „eruptiver Gewalt“.
Meine eigene Einordnung
Aus meiner Sicht hat T. C. Boyle mit diesem Roman eine resignierte, ja beklemmende Einschätzung des Zustands der menschlichen Gesellschaft abgeliefert. – No Way Home: Da führt kein Weg zurück nach Hause in unsere kuschelige Vergangenheit. Alle seine Figuren, Protagonisten wie Nebendarsteller, sind durch die Bank Versehrte, die an sich selbst ebenso wie an ihren Lebensumständen kranken. Sie sind Kraftlose oder aber Gedankenlose und Selbstsüchtige. Im Grunde genommen ist die Erzählung eine Bankrotterklärung der Regelungen unserer Gemeinschaft. Insofern muss ich zumindest der Einschätzung von Frau von Sternburg (siehe oben) beipflichten, der Eindruck von „Lethargie, Passivität“ sei überwältigend.
Man könnte meinen, uns läge hier ein Abgesang auf die menschliche Zivilisation vor, im Zwischenmenschlichen wie im Gesamtgesellschaftlichen. Aber Boyle wäre nicht der, der ihn ausmacht, wenn er seine ernüchternde Dokumentation des Scheiterns nicht anhand einer ganzen Menge von Einschüben gebrochen hätte. Einschübe, die uns sein Personal näherbringen, die sie sympathisch oder interessant machen. Beispiele gefällig?
Arzt bleibt Arzt
Dieser Dr. Terrence Tully ist und bleibt eingefleischter Mediziner. Wem auch immer er begegnet, insbesondere den Randfiguren, die gar keine große Rolle spielen, für alle hat Terry sofort eine ärzliche Diagnose parat. Denn sie alle leiden an irgendetwas und bedürfen einer Behandlung. Als Beispiel möchte ich eine für die Handlung irrelevante Bedienung in einem Schnellrestaurant anführen, eine gewisse Gina:
„Als die Kellnerin kam, begrüßte Bethany sie mit Namen – Gina. […] Gina litt an Seborrhö, deutlich zu sehen am Haaransatz und hinter den Ohren, auch wenn sie es überschminkte. […] Sie stand an der Schwelle zum Übergewicht, und das würde weitere Probleme mit sich bringen: Bluthochdruck, Diabetes, Herzleiden.“
(Seite 34)
Arme Gina, aber so ergeht es sehr vielen der Nebendarsteller im Roman. Doch Terry ist eben nicht nur Arzt, sondern auch ein kalifornischer Demokrat. Als solcher wirft er kritische Blicke auf die republikanisch geprägte Bevölkerung Boulder Citys. Ein Seitenhieb auf das Wahlergebnis 2024, als Donald Trump im kleinsten US-Swing-State Nevada vorne lag. So kanzelt Terry Bethany brüsk ab, als er feststellt, dass sie im Autoradio einen rechtslastigen Bullshitsender eingestellt hatte. An Stellen wie diesen blitzt durchaus Boyles eigene politische Überzeugung durch. Außerdem ist Terry überzeugter Vegetarier und versucht, seinen Alkoholkonsum in Grenzen zu halten. Auch in dieser Hinsicht ist die Figur seelenverwandt zum Autor. (Selbst wenn in der Geschichte wie so häufig in den boylschen Erzählungen durchweg gebechert wird, was die Leber hergibt.)
Das Haus der Feigen
Die zentrale Figur des Romans ist die junge Bethany Begany. Sie ist Auslöserin aller Konflikte und Grund für das unbegreifliche Agieren ihrer beiden männlichen Opfer. Boyle hat seine Protagonistin übrigens auf dem Social-Media-Kanal Bluesky eine Femme fatale genannt. Außerdem widmet der Autor Bethany einen Hintergrundeinschub, den er dem Proll Jesse in die Schuhe schiebt. Den lässt er nämlich über den sexuell konnotierten Vornamen der weiblichen Hauptdarstellerin schwadronieren:
„Bethany war ein biblischer Name, abgeleitet von dem griechischen Wort für ‚Haus der Feigen‘ […]. Sie hatte nicht mal gewusst, was ihr Name bedeutete, bis er es ihr gesagt hatte, und als er anfing, sie ‚Fighouse‘ oder kurz ‚Figgy‘ zu nennen, hatte sie das nicht so witzig gefunden wie er.“
(Seite 258)
Dieser Jesse Seeger muss überhaupt als Urheber vielerlei unangenehmen Tuns herhalten. Er ist eben ein fieser Unbeherrschter. Doch im krassen Gegensatz dazu steht eine Persönlichkeitsfacette des Mannes, die ich nicht recht einordnen kann. Jesse versucht sich nämlich ernsthaft als Schriftsteller, der einen womöglich biografischen Roman über seinen Urgroßvater Asa Seeger in Angriff nimmt. Asa verlor in der Neuzehnhundertdreißigerjahren sein Zuhause, als der Hoover-Staudamm gebaut und der Lake Mead geflutet wurde.
Zwar passt es durchaus ins Bild, dass Jesse seine Creative-Writing-Professorin vögelt. Aber die Zielstrebigkeit, mit der er sich in seine Roman-im-Roman-Geschichte verbeißt, will nicht so recht zu dem Egomanen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne passen, den die Figur sonst verkörpert. Jedenfalls finde ich, dass dieser Bruch Jesse nicht noch interessanter macht; falls das in Boyles Absicht lag.
~
Wer die Besprechungen des bisher letzten boyleschen Romans gern gelesen hat, interessiert sich eventuell auch für den Vorgängerroman Blue Skies, oder aber für den Kurzgeschichtenband I Walk Between the Raindrops, der nach Blue Skies und vor No Way Home erschien. Mehr über den Autor und sein Werk kann man in meinem Autorenprofil über T. C. Boyle nachlesen.
Fazit:
No Way Home lässt die Leserschaft einen eindringlichen Blick auf den Zustand der US-amerikanischen Gesellschaft werfen. Auf einen Zustand, der nicht allzuviel Gutes verheißt. T. C. Boyle zeigt uns, was sich Menschen selbst antun können, aber auch was sie ihren Mitmenschen anzutun in der Lage sind. Homo homini lupus est – vielleicht müssen wir immer wieder daran erinnert werden. Dies jedenfalls gelingt dem Autor geradezu perfekt. Die Welt, in die er uns mitnimmt, ist erschreckend. Und der Schrecken gipfelt in der grotesken Beziehung zwischen den drei Protagonisten Terrence, Bethany und Jesse. Die Geschichte ist keine Empfehlung für Menschen, die nichts für fatalistische Weltsichten übrig haben. Und auch das Ende – nennen wir es einmal: halb offen – macht die Story nicht leichter erträglich.
Ich bin wirklich ziemlich begeistert, eine der Boyle-Geschichten wie ich sie liebe. Und deshalb vergebe ich für No Way Home vier von fünf möglichen Sternen, trotz einiger weniger Ungereimtheiten, die mich die Stirn runzel haben lassen. Ganz sicher werde ich diesen Roman in den kommenden Jahren noch mehr als einmal aus dem Regal ziehen.
T. C. Boyle, No Way Home
EN Liveright Publishing, 2026
DE Carl Hanser Verlag, 2025
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)