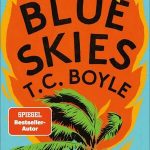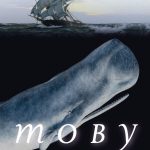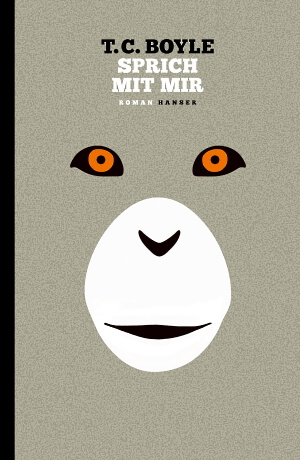
Der Protagonist in T. C. Boyles aktuellem Roman mit dem Titel Sprich mit mir ist kein Mensch, sondern ein Tier: Der Schimpanse Sam erlernt im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments die Gebärdensprache und kann sich dadurch mit menschlichen Gesprächspartnern austauschen. Diese Idee ist simpel und brillant zugleich. Denn sie wirft ohne Weiteres einen ganzen Strauß an Fragen auf:
Wo liegt der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Inwieweit sind Tiere etwa mit Kleinkindern vergleichbar? Ist der wichtigste Unterschied zwischen Menschen und Tieren lediglich in der Sprachbarriere begründet? Oder neigen wir dazu, unsere tierischen Gefährten zu vermenschlichen? Gehen wir denn in angemessener Weise mit unseren Haus- und sonstigen Tieren um? Welche Arten von Beziehungen können zwischen Mensch und Tier bestehen? Was gibt uns, dem Menschengeschlecht, eigentlich das Recht, uns über den Rest der Natur zu erheben?
So unverfänglich die Geschichte um Sam den Schimpansen auch angelegt sein mag: Sie hinterfragt unser gesellschaftliches Wertesystem. Und sie stellt letztlich alle unsere seit Jahrtausenden überlieferten Schöpfungsgeschichten in Frage.
Halten wir es mit dem Heiligen Franz von Assisi, der mit Tieren sprechen konnte? Oder doch eher mit Linguisten im Geiste Noam Chomskys, für den die Fähigkeit des Spracherwerbs humanspezifisch ist und der Tieren einen komplexen sprachlichen Austausch abspricht?
Sind und bleiben für uns Tiere womöglich nach wie vor nichts anderes als Sachen, auch wenn etwa in Deutschland der Paragraf 90a des Bürgerlichen Gesetzbuches längst etwas anderes festlegt: „Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.“
Worum geht es im Roman?
Kalifornien, 1978 – Dr. Guy Schermerhorn ist Privatdozent für Psychologie an der California State University San Marcos in San Diego. Von seinem Mentor Dr. Donald Moncrief aus Iowa, einem Pionier auf dem Gebiet der Aufzucht von Primaten, hat Schermerhorn den jungen Schimpansen Sam zur Verfügung gestellt bekommen. Sam wächst im Rahmen eines Forschungsprogramms im Haushalt der Schermerhorns auf und verständigt sich mittels einer Gebärdensprache mit seinen Menschen. Das Ziel des Programms besteht im Nachweis des Spracherwerbs von Schimpansen.
(Um Missverständnissen vorzubeugen: Allen Primaten fehlen Gehirnstrukturen, mit denen sie ihren Sprachapparat steuern könnten. Das weiß natürlich auch Boyle. Sam und seine Artgenossen sprechen daher nicht akustisch, sondern mittels Gebärdensprache.)
Sam hält seine Betreuer ständig auf Trab, so dass Guys Ehefrau Melanie die Konsequenzen gezogen und ihren Mann und seinen Schimpansen verlassen hat. Das entstandene Loch füllen soll eine studentische Hilfskraft. Und als die Pädagogikstudentin Aimee Villard bei Schermerhorn erscheint, sind sie und Sam einander von einem Augenblick auf den anderen verfallen; ja, anders kann man es einfach nicht sagen:
Er sprang, und sie fing ihn auf, und es war das Natürlichste von der Welt, die Arme um ihn zu legen und ihn an sich zu drücken und das Klopfen seines Herzens an der Brust zu spüren. Es war ein intensiver Augenblick, der intensivste ihres Lebens, elektrisierend, als würde man einen Stecker in die Steckdose stecken. Hier war ein Tier, ein wildes Tier, das ihr vollkommen unbekannt war, ein wildes Tier, dessen Eltern noch im Dschungel von Westafrika gelebt hatten, und plötzlich gehörte es – er – zu ihr. Und sie zu ihm.
(Seite 42)
Das Projekt kippt
Ein gutes Jahr lang läuft das Forschungsprojekt außerordentlich erfolgreich; nicht zuletzt dank Aimees enger Bindung mit Sam. Dann aber kippt das Projekt. Die Möglichkeit des Spracherwerbs durch Primaten wird in wissenschaftlichen Publikationen angezweifelt, daraufhin werden Forschungsgelder gestrichen.
Nach sechs Jahren endet Sams Aufenthalt in Schermerhorns Haus. Dr. Moncrief fordert sein Eigentum zurück und bringt den Schimpansen wieder nach Iowa in seine Aufzuchtstation. Sam wird aus seinem Zuhause gerissen und in einen Käfig gesperrt, unter angsteinflößende Artgenossen, die er nach langen Jahren seiner Kindheit und Jugend unter Menschen nicht als solche wahrnimmt und die nicht auf seine Gebärdensprache reagieren.
Teil II
Aimee findet sich nicht mit der Trennung von Sam ab. Mit dem Auto reist sie ihm von Kalifornien bis nach Iowa nach. Sie bietet Moncrief an, ohne Bezahlung für ihn zu arbeiten, nur um in Sams Nähe zu sein.
Als Moncrief ankündigt, seine Schimpansen an biomedizinische Forschungsprojekte verkaufen zu wollen, kommt es zum Eklat: Aimee flieht mit Sam aus der Aufzuchtstation in Iowa. Die beiden finden Zuflucht auf einem Campingplatz in einem gottverlassenen Nest in Arizona. Was letztlich in Teil III geschieht, werde ich hier nicht verraten. Obwohl zumindest eingeräumt werden muss, dass das Attribut „gottverlassen“ nicht zutreffend ist; worüber noch zu schreiben sein wird.
Wer spricht denn da?
Schon nach den ersten vierzig Romanseiten fällt der beständige Wechsel der Berichtsposition des Autors auf. Zwar schreibt Boyle durchgehend aus einer allwissenden Erzählperspektive, stets in der dritten Person. Und doch lässt er in jedem Kapitel dediziert einen anderen seiner Protagonisten zu Wort kommen und die Leserschaft in die Gedanken der jeweiligen Person eintauchen. Aber wenn ich hier von „Personen“ schreibe, dann ist das womöglich nicht ganz korrekt, denn mindestens gleichberechtigt kommen Guy Schermerhorn, Aimee Villard und ebenso Sam der Schimpanse zu Wort. Andererseits ist ja genau diese Frage, nämlich ob Sam wenn schon kein Mensch dann doch eine Person ist, eines der zentralen Themen der Geschichte.
Jedenfalls startet die Erzählung mit einem Kapitel-Pingpong. Jeweils eine Sequenz aus den Geschehnissen in und um San Diego wechselt sich ab mit einem düsteren Abschnitt aus der Perspektive Sams, die sich alle sehr bald einer Zukunft zuordnen lassen, in der der Schimpanse als Gefangener in einer Primatenstallung gehalten und gequält wird. Diese beiden Erzählstränge laufen irgendwann zusammen, nämlich in dem Moment, in dem Moncrief seinen Schimpansen aus dem Universitätsprojekt abruft und nach Iowa bringt.
Im weiteren Verlauf der Geschichte zieht Boyle das Geschehen auseinander wie die verschiedenen Farbschichten eines digitalen Bildes, das aus Yellow, Cyan und Magenta besteht. Den drei Farben entsprechen im Roman die Sichtweisen von Aimee, Guy und Sam; jeder der drei schildert die gleiche Episode aus seinem Blickwinkel. Ganz besonders augenfällig in einer Szene auf dem Campingplatz in Arizona, in der es zum Zerwürfnis zwischen Aimee und Guy kommt.
Mensch oder Tier?
Durch diesen durchgehenden Perspektivenwechsel konstruiert der Autor eine Atmosphäre wie in einem Schiedsgericht, Boyle macht uns, die Leserschaft zur Jury, die sich alle Aussagen anhören darf oder muss, um letztlich eine Bewertung zu finden.
Wie halten wir es denn nun? – Wer oder was ist dieser Sam eigentlich? T. C. Boyle hütet sich davor, uns eine eindeutige Meinung vorzugeben. Denn das menschliche Personal seiner Romangeschichte vertritt verschiedene Positionen in dieser Frage. Aimee, der weibliche und ganz besonders gefühlsbetonte Pol, sieht in ihrem Sam vielleicht keinen Menschen, aber zumindest etwas, was mit dem Homo Sapiens doch auf einer Stufe steht. Die Gegenposition dazu ist Dr. Moncrief, für den seine Primaten ausschließlich eine Geldquelle darstellen und der keinen Hehl daraus macht, dass er Freude daran hat, seine Gefangenen zu dominieren und zu drangsalieren. Guy Schermerhorn schließlich liegt mit seiner Bewertung irgendwo zwischen den beiden Polen. Er empfindet zwar durchaus Empathie gegenüber Sam, aber sieht in dem Schimpansen letztlich doch in erster Linie einen Antriebsmotor für seine wissenschaftliche Karriere.
„Ein Kind des Lichts“
Im Gespräch mit einem katholischen Priester, der sie auf Sam anspricht, diskutiert Aimee die Fragestellung aus religionstheoretischer Sicht. Die Kirche lehre, dass Tiere keine unsterbliche Seele haben, hält Pater Curran den Status Quo fest. Doch er zeigt sich durchaus beeindruckt von Sams Sprachverständnis und von seinen Unterhaltungen mit dem Schimpansen. Also kommt es kurz darauf dazu, dass Curran einen Schimpansen auf den Namen Samuel tauft.
In den Kapiteln, die aus Sicht von Sam formuliert sind, schiebt Boyle hingegen immer wieder Hinweise ein, die uns mit der Nase darauf stoßen: Sam verhält sich nur deshalb so menschlich, weil er das Belohnungssystem seiner Betreuer durchschaut hat. Wenn er „süß“ sein soll und sich daran hält, dann gibt es Zuckerbrot statt Peitsche. Wir müssen uns fragen, ob es da einen Unterschied etwa zur Konditionierung Pawlowscher Hunde gibt. Und schließlich gelangt sogar Aimee zu einer erschreckenden Erkenntnis über ihren Liebling:
Er war komisch und liebenswert und noch etwas anderes – sie sah es zum ersten Mal, und es jagte ihr einen Schauer über den Rücken: Er war berechnend. Er war kein Mensch, aber auch kein Tier, sondern etwas dazwischen, etwas Unnatürliches, Deformiertes, auch wenn Pater Curran sich hatte täuschen lassen.
(Seite 323)
Gebärdensprache
Da wir gerade bei Pater Curran gelandet sind, möchte ich ein paar Bemerkungen zum Sprachwitz einflechten, der aus meiner Sicht wichtiger Bestandteil der Attraktivität des Romans ist. Den katholischen Geistlichen in seiner langen Soutane nennt Sam KEINE BEINE. Ein Erfüllungsgehilfe des bösen Moncrief, der bei jedem Wetter im T-Shirt mit bloßen Oberarmen auftritt, heißt bei Sam ARME. Und seine eigene Spezies, die Schimpansen, auf die er erstmalig bei Moncrief im Affenstall trifft, sind die SCHWARZEN KÄFER.
Unwillkürlich habe ich bei solchen Bezeichnungen an die Schafe im Roman Glennkill denken müssen, die ja auch ihre Spezialnamen für Menschen haben.
Die Großbuchstaben sind übrigens nicht meine Erfindung. Boyle verwendet sie nämlich immer dann, wenn zwischen Sam und seinen Betreuern gebärdet wird. Mit diesem Trick schafft er es tatsächlich, Unterhaltungen im raschen Fluss darzustellen, ohne Zeit mit Erklärungen verschwenden zu müssen.
Interessant in Bezug auf das Gebärden sind aber auch Szenen, die sich in der Primatenzuchtstation in Iowa zutragen. Dort trifft Sam schließlich nicht nur auf seine SCHWARZEN KÄFER, sondern auch auf die Schimpansin Alice aus einem anderen universitären Forschungsprojekt. Und tatsächlich unterhalten sich Alice und Sam mittels der erlernten Gebärdensprache. Was auch immer die Leserschaft von dieser Möglichkeit hält: Autor Boyle lässt keinen Zweifel daran, dass er an den Spracherwerb durch Primaten glaubt.
Reiz und Magie der Geschichte
Wie so oft in seinen Romanen gelingt es T. C. Boyle auch diesmal wieder, seine Leser¦innen in die Handlung geradezu hineinzusaugen. Sprich mit mir gehört zu den seltenen Romanen, die ich nur mit einer einzigen Unterbrechung, also sozusagen beinahe an einem Stück gelesen habe. Dies liegt mit Sicherheit wieder einmal an der legendären Erzählkunst des Autors, der eben ein untrügliches Gespür dafür hat, das Interesse seiner Leserschaft immer wieder von neuem anzuheizen.
Aber kommen wir zurück auf die Fragestellungen, die der Autor mit seinem Roman aufwirft:
Die erste Frage, ob wir angemessen mit anderen Arten auf unserem Planeten umgehen, beantwortet Boyle eindeutig: So darf es nicht weitergehen! Diese Antwort kann nicht verwundern, wenn man Tom Coraghessan Boyle nur ein kleines bisschen kennt. Wer etwa seinem Twitter-Account folgt, der weiß mit Sicherheit um die Naturverbundenheit und Tierliebe des Schriftstellers.
Auf die zweite große Frage, nämlich der nach den Fähigkeiten unserer biologisch nächsten Verwandten, der Schimpansen, fällt Boyles Antwort nicht ganz so glasklar aus. Zwar attestiert er Sam und anderen Primaten aus universitären Forschungsprojekten zweifellos die Fähigkeit zum Spracherwerb. Aber er will sich und seine Leserschaft nicht festlegen, wo diese und ähnliche Fähigkeiten im Vergleich zum Menschen enden.
In diesem Zusammenhang möchte auf eine Novelle mit dem Titel Das wilde Kind hinweisen, die T. C. Boyle bereits elf Jahre vor dem Roman um Sam veröffentlichte. Darin geht es um die versuchte Sozialisierung samt Spracherwerb eines sogenannten Wolfskindes.
Die dritte, womöglich wichtigste Frage lässt der Autor weitgehend offen. Ja, bekanntlich ist der genetische Code von Menschen und Schimpansen zu 99 Prozent identisch. Worin uns aber dieses letzte Prozent trennt, lässt sich bislang nicht schlüssig beantworten. Jedenfalls, so verstehe ich Boyle, ist es nicht hilfreich, Lebewesen zu vermenschlichen; auch oder gerade dann nicht, wenn deren Verhaltensweisen besonders gut zu den Reaktionen passen, die Menschen erwarten. Das führt immer nur zu Problemen.
Einschränkungen?
Zuletzt muss ich noch ein kleines bisschen auf hohem Niveau jammern. An einigen Stellen des Textes bin ich Wiederholungen begegnet, bei denen eine innere Stimme aufbegehrte: Ja, das wissen wir ja nun schon!
Insbesondere in manchen der stimmungsgeladenen Kapitel, in denen Sam aus seiner Käfighaft heraus berichtet hätte ich mir etwas weniger dicken Aufstrich gewünscht. Aber das ist vermutlich Ansichtssache. Denn um Sams Stimmungslage umfassend einzufangen, können wohl auch solche Wiederholungen dazugehören.
~
Wer diese Rezension gern gelesen hat, interessiert sich eventuell auch für das Autorenprofil, das ich zu T. C. Boyle angelegt habe und in dem auch alle anderen Buchbesprechungen von Boyle-Romanen auf dieser Website zu finden sind. Sprich mit mir erschien zwei Jahre nach Das Licht und zwei Jahre vor Blue Skies.
Fazit:
T. C. Boyle widmet seinen Roman Sprich mit mir seiner im Jahr 2019 verstorbenen Schwester Kathleen Elizabeth. Und ich empfehle ihn in erster Linie allen Leserinnen und Lesern, die sich Gedanken um den Umgang des Menschen mit unserem Planeten machen. Wer sich darüber hinaus auch für Verhaltensforschung oder die Verwandtschaft der Arten interessiert, kommt hier voll auf seine Kosten. Aber auch wer einfach nur eine äußerst unterhaltsame Geschichte im unverwechselbaren boyleschen Stil zwischen Menschelei und Gesellschaftskritik sucht, wird seine Freude an Sprich mit mir haben.
Mein negativer Kritikanteil hält sich in sehr, sehr engen Grenzen, und so bekommt der Roman auf jeden Fall dicke vier von fünf möglichen Sternen.
T. C. Boyle: Talk to me
| Sprich mit mir
🇬🇧 Bloomsbury Publishing, 2021

* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)