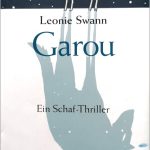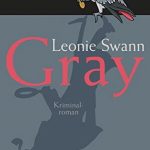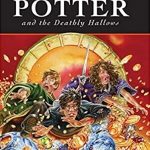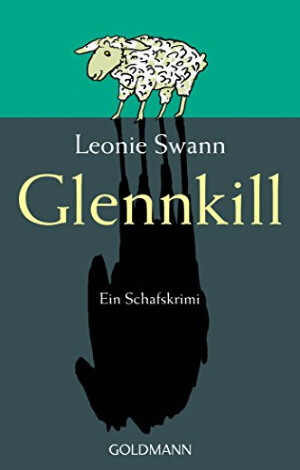
Das Romandebüt von Leonie Swann, einer jungen, deutschsprachigen Autorin, hat sich viele Wochen lang festgesetzt in den Bestsellerlisten des Buchhandels: Glennkill. Ich will einmal beleuchten, welche Qualitäten diesem „Schafskrimi“ zu derartig enormer Beachtung verhelfen. Denn obwohl internationale Vorabkritiken das Buch teilweise hymnisch feierten, gab es im Nachhinein doch auch eine ganze Menge negativer Bewertungen. Offenbar polarisiert der Roman die Leserschaft in hohem Maße.
Woran das liegt, lässt sich bereits anhand des Umschlagaufdruckes erklären. Über den Titel Glennkill kann man sich schon nach wenigen Seiten amüsieren, wenn man erfährt, dass in der irischen Ortschaft gleichen Namens ein Schäfer namens George Glenn ermordet wurde. Humorige Randnotizen auf diesem Niveau ziehen sich durch die Geschichte wie ein roter Faden.
Der Untertitel jedoch, Ein Schafskrimi, erzeugt bei vielen Lesern eine Erwartungshaltung, der die Autorin nicht gerecht wird, womöglich sogar nicht einmal gerecht werden wollte. Der Untertitel suggeriert nämlich spannende Mörderjagden, brilliante kriminalistische Schlussfolgerungen, gekonnt gelegte falsche Spuren, möglicherweise rasante Actionszenen. Jedenfalls aber ein unerwartetes und dennoch plausibles Ende in Form der Enttarnung eines brutalen Mordgesellen. Diese Bestandteile klassischer Kriminalromane hat Glennkill nicht zu bieten. Es ist schlicht und einfach kein Krimi.
Worum es geht
Zwar besteht die vordergründige Handlung darin, dass eine Schafsherde am frühen Morgen ihren Schäfer tot, einen Spaten in seinen Eingeweiden steckend auf der Weide vorfindet. Die Schafe machen sich daran herauszufinden, wer George ermordet hat. Tatsächlich machen dann auch einen nicht unerheblicher Teil des Inhalts Ermittlungen nach Schafsart aus.
Doch der kriminalistische Part bleibt stets zweitrangig, überdeckt von der Schafsgeschichte. Die Auflösung des Falles und ganz besonders der Versuch der Schafe, den Menschen ihren Mordverdacht mitzuteilen, haben dann mit dem Genre Krimi gar nichts mehr zu tun. Genau daran stoßen sich die enttäuschten Krimifans und kritisieren den Roman als zum Gähnen langweilig.
Unbestritten können Swanns Schafe in Sachen Ermittlungstechnik und Schlüsseziehen nicht annähernd mithalten mit anderen tierischen Detektiven. Etwa mit Akif Pirinccis kriminalistischem Kater Francis. Oder mit Michael Endes Kater Maurizio und dem Raben Jakob aus Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch. Allerdings unternimmt die Autorin von Glennkill überhaupt nicht erst den Versuch, ihre vierbeinigen Protagonisten als menschliche Ermittler in Tiergestalt auf Mördersuche zu schicken.
Halten wir also fest, dass es sich trotz der untertitelten Ankündigung mitnichten um einen Kriminalroman handelt. – Was sonst bleibt übrig?
Eine erfrischende Idee und Humor
Das ungewohnt Neue besteht in der Erzählperspektive des Romans. Die Geschichte wird ausschließlich aus der Sicht der Mitglieder einer Schafsherde an den Leser herangetragen.
Dies beginnt bei den treffend beschriebenen Eigenschaften und Verhaltensweisen der einzelnen Herdentiere. Selbst versierte Schafshalter räumen ein, dass sich Tiere in der Realität durchaus so verhalten wie die Protagonisten des Romans. Über allem stehen die Fixierung auf das Grasen und das Gebot, den Verband der Herde nicht zu verlassen. Hinzu kommt eine artspezifische Ängstlichkeit – in ungewöhnlichen Situationen brechen stets „Wolf!“-Geblöke und Panikverhalten aus. Charakteristisch für den Handlungsverlauf sind auch das Ausblenden von Erklärungsmöglichkeiten, die den (angenommenen) Horizont von Schafen übersteigen, und ein in der Regel schwaches Langzeitgedächtnis.
Leonie Swann lässt ihre Schafe zwar die menschliche Sprache verstehen, denn ohne diese dichterische Freiheit würde die ganze Geschichte einfach nicht funktionieren. Aber sie verzichtet darauf, den Tieren sonstige menschliche Leistungsmerkmale anzudichten. Mensch ist Mensch, und Schaf bleibt Schaf. Die Autorin hat sich konsequent in ihre vierbeinigen Helden hineingedacht. Sehr überzeugend kommt das zum Beispiel in der Schlussszene des Buches zum Ausdruck. Darin wird beschrieben, welche Gefühle einen Widder zu Beginn der herbstlichen Paarungszeit umtreiben.
Erfolgsrezept
Die Reduzierung auf das Tierische bringt allerdings nicht automatisch die Annahme mit sich, dass Schafe per se eine minder bemittelte Spezies darstellten. Die Tiere sind schon sehr selbstbewusst, wenn sie etwa in Frage stellen, dass Menschen eine Seele besitzen, weil diese bekanntlich an den Geruchssinn gebunden ist. Dieser sei bei Menschen im Vergleich zum Schaf ja sehr schwach ausgeprägt.
Die Prämisse der gleichen Augenhöhe zwischen Mensch und Schaf verwendet Swann dazu, die Fehler und Probleme der Menschen aus dem definierten Blickwinkel der Schafswelt zu beleuchten:
Gerüche entscheiden über Einteilung in Gut und Böse, aus menschlicher Sicht normales Verhalten wirkt auf einmal irrational. Damit erreicht die Autorin, dass der aufmerksame Leser sein eigenes, nur allzu menschliches Verhalten in Frage stellt. Man fühlt sich ertappt. Tierfleisch zu essen, Alkohol zu trinken, zu rauchen, oder etwa auch religiöse Praktiken auszuüben erscheinen plötzlich absurd. In letzter Konsequenz wird auch die menschliche Entscheidung zum Freitod als absolut unverständlicher Schritt dargestellt. – „Es ist nicht einfach, die Menschen zu verstehen.“
Logik & Komik
Nicht immer sorgt die Diskrepanz zwischen menschlichen und schafsköpfigen Denkmechanismen zu solcher Gedankentiefe. In der Mehrzahl der Fälle nutzt die Autorin die Unterschiede zwischen Mensch und Schaf für Situationskomik, die schon mal für Schenkelklopfer sorgt. Komik entsteht besonders dann, wenn Schafe Alltäglichkeiten des menschlichen Lebens lapidar aus aus ihrer wissensreduzierten Sicht kommentieren.
Das beginnt schon im ersten Absatz des Romans, wenn das Schaf Maude den Tod des Schäfers kommentiert mit „Gestern ging es ihm noch gut.“ Die Erwiderung des Leitwidders der Herde lautet: „Das sagt gar nichts. Spaten sind keine Krankheit.“
Religion & Opium für das Volk
Sehr schön fand ich auch die Schlussfolgerung, dass der Geistliche von Glennkill dieser „Gott“ sein müsse, von dem die Menschen so oft sprächen. Schließlich wohne er im „Haus Gottes“. Konsequent lässt Leonie Swann den Mann in der Folge stets als Gott auftreten. Mit der Religion treibt die Autorin überhaupt gern Späßchen. In einer der gelungenen Romanszenen erleichtert der Priester in Umkehrung der Rollen im Beichtstuhl sein Gewissen. „Gott“ beichtet jedoch, ohne zu ahnen, dass anstelle des vermuteten Gesprächspartners auf der anderen Seite des Gitterfensters ein Schaf sitzt.
Auch die Beschreibung einer Beerdigung aus völlig unvoreingenommener und schließlich entsetzter Sicht eines Schafes gehört zu den Glanzlichtern des Romans.
Ein weiterer Running Gag, der durch den gesamten Roman wandert, besteht in der Doppeldeutigkeit des Begriffes „Gras“. Für die Schafe ist Gras in all seinen minutiös beschriebenen Arten wichtigster Lebensinhalt. Deshalb wundern sie sich zunächst kein bisschen, als sich herauszustellen scheint, dass irgendwelche versteckten „Gras“-Reserven mit dem Tod ihres Schäfers zu tun haben sollen. Erst nachdem ein besonders gefräßiges der Schafe ein ganzes Päckchen Marihuana auffrisst und sogleich in ohnmachtsähnlichen Tiefschlaf versinkt, wird ihnen klar: Menschen haben Interesse an ganz anderen Grassorten als sie selbst.
Leonie Swanns Humor
Der Humor der Autorin manifestiert sich gern auch in Vordergründigkeiten wie dem bereits genannten Wortspiel zwischen dem Ortsnamen Glennkill, dem Tötungsakt und dem Opfer mit dem Nachnamen Glenn. In die gleiche Richtung geht die Namensgebung beim Personal. So heißt das klügste Schaf der ermittelnden Herde Miss Maple, Agatha Christie lässt grüßen; und Abraham Rackham, der Metzger des Dorfes, wird „Ham“ gerufen.
Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass diese Art von Humor doch arg flach ist. Mir hat sie trotzdem Spaß bereitet.
Einer der häufig geäußerten Kritikpunkte aus der Leserschaft nimmt die zahlreichen Wiederholungen im Text aufs Korn. Man muss in einer Schafsgeschichte wohl hinnehmen, dass ein Großteil der Zeit mit dem Grasen verbracht wird. Aber man muss wirklich einräumen, dass die schafsköpfigen Helden auffällig häufig „die Nerven verlieren“ und „mit den Ohren schlackern“. Ein etwas sorgfältigeres Lektorat hätte solche Häufungen vermeiden können.
Ziemlich hilflos stand auch ich einigen (glücklicherweise seltenen) Einschüben gegenüber, die mit der Geschichte nichts zu tun haben und in meiner Ausgabe durch Kursivdruck vom Rest des Buches abgesetzt waren. Es handelt sich um eine Art schafspsychologische Esoterik eines zurückkehrenden Ausreißerschafes, besser kann ich den Inhalt in Kürze nicht beschreiben. Jedenfalls hätte dem Roman wahrscheinlich nichts gefehlt, hätte die Autorin auf diese Passagen verzichtet.
Ein Nebeneffekt der vereinfachenden Schreibe auf dem gedanklichen Niveau von Schafen ist die Tatsache, dass man die Geschichte selbst Schulanfängern ganz gut vorlesen kann, obwohl sich der Roman eigentlich eher an Jugendliche und Erwachsene richtet. Dank der behäbigen Schafslogik können auch Jüngere der Handlung problemlos folgen, nur an wenigen Stellen ist das Vokabular erläuterungsbedürftig.
~
Wer diese Rezension gern gelesen hat, der wird vielleicht auch Interesse an meiner Besprechung der beiden Nachfolger Garou und Gray haben.
Fazit:
Über die Maßen anspruchsvolle Literatur ist Glennkill wohl nicht. Auch passionierte Krimiliebhaber werden sich rasch gelangweilt von der Lektüre verabschieden. Aber die Idee, der Menschheit einmal den Spiegel vorzuhalten, indem man ihr Verhalten auf einfachst möglicher Ebene porträtiert, wäre mir durchaus vier Sterne wert gewesen. Auf Grund der beschriebenen Schwächen gibt es aber Abzüge. Drei von den fünf möglichen Sternen verleihe ich der Geschichte aber ohne Zögern. – Etwas mehr als nur humorvolle Unterhaltung für Leser, die gerne hinter vordergründige Abläufe blicken.
Leonie Swann: Glennkill
Goldmann Verlag, 2005
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)