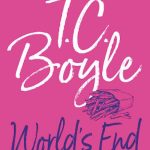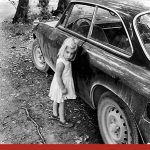T. C. Boyles Kurzgeschichten sind meist schmerzhaft erhellend, sein Humor rabenschwarz. Die Geschichten in seiner dritten Sammlung, Wenn der Fluss Whiskey wär, befassen sich mit gesellschaftlichen Missständen und menschlichen Abgründen. Dabei lassen sie nie die absurden Details unseres zeitgenössischen Lebensstils außer Acht. Und für jeden seiner Seitenhiebe auf Amerika hat Boyle einen guten Lacher parat, auch wenn einem der oft im Halse stecken bleibt. Seine Königsdisziplin ist die moderne Fabel über Menschen unserer Gesellschaft, die beinahe Karikaturen sind, noch nicht ganz unglaubwürdig, aber auf dem besten Weg dorthin. In diesem Sammelband, den er 1989 im englischen Original zwischen die beiden Romane World’s End und Der Samurai von Savannah geschoben hat, wandelt Boyle manchmal hart an der Grenze zum Wahnwitz.
Mit der vorliegenden Besprechung von Boyles dritter Kurzgeschichtensammlung schließe ich die letzte Lücke unter meinen Rezensionen von Veröffentlichungen des US-Autors in den ersten drei Jahrzehnten seines Schaffens. Wer sich für einen vollständigen Überblick interessiert, könnte sich an meiner Liste aller Romane oder aller Kurzgeschichtenbände orientieren. (Dort finden sich auch die Links zu allen Einzelbesprechungen.)
Worum es geht
„Vierzehn Geschichten aus Amerika. Vierzehn Geschichten vom Kochen und Vögeln, von Alarmanlagen, Fliegenmenschen, mörderischen Adoptivkindern, dem Teufel und der Heiligen Jungfrau.“
Ich gestehe, dass dies einer der seltenen Fälle ist, in dem mir der Klappentext auf der Buchrückseite ausnehmend gut gefällt und ich ihn deshalb hier zitiere. Hinzufügen könnte man der Vollständigkeit halber noch einen selbstmörderischen Spindoctor, zwei frustrierte Ehefrauen, das Bäumchen wechsel dich von Big Timber, die Heimkehr des Treulosen, Korruption in Chile, den Schimpansen von Connecticut und den Jungen mit seinen alkoholkranken Eltern.
~
1. — Erbärmlicher Fugu
EN Sorry Fugu
Haute Cuisine. Michelinsterne. International renommierte Spitzenköche kreieren Außergewöhnliches für verwöhnte Gaumen. Und dann fallen Restaurantkritiker wie Heuschrecken ein ins kulinarische Idyll und zerfetzen den mühsam erarbeiteten Spitzenruf in der Luft:
„Die Ente war zu etwas verbrutzelt, was man als Bodensatz in den tiefsten Tiefen einer Graburne zu finden erwarten würde.“
(Seite 7)
Boyles erste Kurzgeschichte zieht sich über dreiundzwanzig Textseiten und drei Abende im italienischen Gourmettempel D’Angelo in Los Angeles hin. Chefkoch Albert bekommt Besuch von der gefürchtetsten Gastronomiekritikerin der Stadt. Willa Frank ist berüchtigt für ihre bodenlosen Verrisse. Wird es Albert gelingen, die Frau und ihren rustikalen Vorkoster Jock von der Qualität seiner Küche zu überzeugen? Notfalls vielleicht mit einem nicht ganz sauberen, aber jedenfalls unerwarteten Trick? Wird die scharfzüngige Willa Albert aus der Hand fressen?
Ein satirischer Ausflug in eine ganz besondere Welt. Eine Welt, mit der der Autor nicht viel gemein hat und die er mit unübersehbarem Vergnügen zerpflückt.
★★★
2. — Moderne Liebe
EN Modern Love
Kurzgeschichte Nummer zwei erzählt über den Beginn einer Paarbeziehung zwischen zwei jungen Leuten um die dreißig, die im Speckgürtel New Yorks zu Hause sind. Der namenlose Ich-Erzähler lernt die hübsche Breda kennen. Doch es dauert, bis sich die beiden körperlich näher kommen. Das liegt allerdings nicht daran, dass eine(r) von ihnen besonders prüde wäre, oder religiös. Der Grund ist die extrem ausgeprägte Hypochondrie Bredas. Im Laufe der fünfzehn Textseiten habe ich die Namen von mindestens neunzehn Krankheiten gelesen, von Aids bis Onchozerkose. Und von wahrscheinlich ebenso vielen Schädlingen oder Parasiten.
Ich erwähnte bereits, dass sich die beiden schließlich doch körperlich näher kamen – „Aber so nah nun auch wieder nicht.“ (Zitat Schlusssatz). Wie die Beziehung endet, brauche ich sicher nicht zu erwähnen. Schließlich ist die Geschichte von Boyle.
★★★
3. — Schwieriger Kunde
EN Hard Sell
Großspurig, arrogant, selbstgefällig und dabei doch dumm wie Bohnenstroh; so lässt Boyle den Erzähler seiner dritten Geschichte daherkommen. Der Mann ist irgend so ein Spindoctor, also einer, der seinen Kunden ein aufgesetztes Image verpasst, damit sie in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen werden. Die Erzählung ist nur neun Seiten lang und besteht aus einem Monolog des unsympathischen Imageberaters, den dieser an einen imaginären Zuhörer namens Bob richtet. Der ganze Monolog ist eine pausenlose Selbstbeweihräucherung des Kerls, aus der hervorgeht, wie erfolgreich seine aktuelle Beratung eines außergewöhnlich schwierigen Kunden verläuft.
Der Witz der Geschichte besteht in der Tatsache, dass dieser schwierige Kunde ein greiser, islamischer Revolutionsführer ist, dem der PR-Mann einzureden versucht, wie beschissen er mit seinem Turban, dem Bart und diesem Bademantel rüberkommt und dass er „diese ganze Dschihad-Kacke“ doch besser weglassen und sich als Baseballfan outen solle. Die Frage ist: Ob der Spindoctor das überleben wird?
Eine grandiose Persiflage auf den Umgang der USA mit dem Ajatollah Khomeini nach dem Sturz des persischen Schahs. Und irgendwie musste ich sofort an Donald Trump und Ajatollah Ali Chamenei denken, obwohl die vorliegende Kurzgeschichte natürlich schon fünfundvierzig Jahre alt ist.
★★★★
4. — Seelenfrieden
EN Peace of Mind
Das Geschäft mit der Angst blüht. Giselle Nyerges ist Top-Verkäuferin einer Alarmanlagenfirma. Ihr Erfolgsgeheimnis besteht darin, die Interessierten mit gruseligen Geschichten in Angst und Schrecken zu versetzen, um ihnen dann irgendein teures Sicherheitspaket aufzuschwätzen. Zu deren Seelenfrieden.
Auf neunzehn Buchseiten erzählt uns T. C. Boyle eine geradezu wahnwitzige Verstrickung von Begegnungen rund um Giselle, die schließlich dazu führt, dass ein gefrusteter und gewaltbereiter Frührentner Amok läuft und bei einem von Giselles Kunden ein Blutbad anrichtet – und zwar nicht trotz, sondern gerade wegen der Abschreckungsmaßnahmen zum Schutz seines Grund und Bodens.
Eine nachdenklich stimmende, drastische Erzählung, die der Leserschaft klar macht: Die Bedrohung kommt in den meisten Fällen nicht von denen, die stets als grausige Beispiele für zügellose Gewalt herhalten müssen – dem „Schwarzen, der eine Maske von Präsident Reagan trug“, dem „Mexikaner vom Scherenschleifdienst“, oder dem „Schlüpfer-Vergewaltiger, der seine Opfer mit ihrer eigenen Unterwäsche knebelt“. Denn die wahre Bedrohung kann von unserem Nachbarn ausgehen. Oder von irgendeinem Passanten, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Dagegen hilft auch die teuerste Alarmanlage nicht.
★★★★
5. — Das sinkende Haus
EN Sinking House
Eine abgedrehte Erzählung über Frauen, Ehefrauen, Hausfrauen, die ihr Leben lang von ihren Männern unterdrückt, als Gerätschaften missbraucht, beschimpft und gequält wurden. Und auch eine Geschichte über Frauengenerationen, über die ewige Wiederkehr des Gleichen. Die junge Meg und die ältere Dame Muriel sind Nachbarinnen. Muriel ist frisch verwitwet und heilfroh, dass ihr Mann Monty endlich tot ist. Jahrzehntelang hatte sie unter seinen Launen und seiner Unterdrückung gelitten. Irgendwie hat Muriel das Gefühl, Montys Terror abwaschen und aus ihrem Leben herausspülen zu müssen. Denn kaum hat ihr Mann seinen letzten Atemzug getan, dreht die Witwe sämtliche Wasserhähne in Haus und Garten auf und setzt nicht nur das Gebäude, sondern die gesamte Nachbarschaft unter Wasser. Ja, Muriels Haus sinkt. Zumindest solange bis die Polizei sie abholt und die Wasserspiele beendet.
Parallel zur Geschichte Muriels erzählt Boyle auf diesen siebzehn Seiten aus dem Leben der jungen Nachbarin Meg, einer jungen Mutter und Ehefrau, die auf dem besten Weg ist, Muriels Nachfolge anzutreten, das fremdbestimmte Leben Muriels zu wiederholen. Die Erzählung endet damit, dass Meg nach der polizeilichen Festnahme Muriels alleine in deren völlig durchgeweichtem Garten steht:
„Und dann überkam es sie. Sie würde sie aufdrehen – die Rasensprenger –, nur ganz kurz, um zu sehen, was das für ein Gefühl war. Sie würde sie nicht lange anlassen – es könnte sonst das Fundament ihres eigenen Hauses gefährden. Das jedenfalls wusste sie.“
(Zitat Schlusssatz)
★★★★
6. — Der Fliegenmensch
EN The Human Fly
Der Fliegenmensch von T. C. Boyle ist eine rasante Lektüre, die die Leserschaft in die Welt eines Talentagenten entführt, der wenig erfolgreich in einer großen Unterhaltungsagentur arbeitet. Eines Tages wird er von einem Mann angesprochen, der sich selbst als „La Mosca Humana“, also als „die menschliche Fliege“ bezeichnet. Dieser Zoltan Mindszenty hat während der gesamten Geschichte nur ein Ziel vor Augen: Er will berühmt werden. Dafür unternimmt er verschiedene Stunts und wird damit und mit Hilfe des Agenten tatsächlich zur Medienpersönlichkeit.
Im Laufe der vierundzwanzig Textseiten hatte ich immer stärker den Verdacht, die Geschichte könnte wieder eine von Boyles biografischen Erzählungen sein. Allerdings haben meine Recherchen keinen Anhaltspunkt dafür ergeben. Ehrlich gesagt hat mich diese Kurzgeschichte nicht wirklich erreicht.
★★
7. — Die Mütze
EN The Hat
Mit den dreiundzwanzig Seiten dieser Kurzgeschichte erreichen wir nicht nur die Mitte des Bandes, sondern auch einen erzählerischen Höhepunkt dieser Sammlung. Hier ist Boyle hundertprozentig in seinem Element. Es geht um Archaisches, ein wenig ums Überleben in der Härte der Natur und um die Bedrohung durch Wildtiere, um raue Kerle und um Loser; vor allem aber geht es um zentrale Themen der Zivilisation: Wer schläft mit wem? Wer gehört zu wem? – Und natürlich auch: Wer gehört wem?
Die Erzählung spielt in einer erfundenen Bergsiedlung namens Big Timber in den südlichen Ausläufern der kalifornischen Sierra Nevada. Die meisten der rund hundert Häuschen sind Urlaubsbehausungen begüterter Küstenbewohner, die entweder im heißen Sommer hinauf in die Berge kommen, oder aber im Winter zum Langlauf. Es gibt nur einen „harten Kern von siebenundzwanzig asozialen Typen, die diesen Ort das ganze Jahr über ihr Zuhause nannten“. Zu diesen gehören der Erzähler – ein gewisser Michael Koerner –, der Hüttenwirt Marshall und dessen Schankkellnerin Jill. Hinzu kommen in diesem Winter zwischen Thanksgiving und Neujahr einige Gäste. Da ist zum Beispiel die Stammgästin Regina aus Los Angeles, die jeden Winter in Big Timber auftaucht, um mit ihren Kurven die Dorfbewohner zu beeindrucken; insbesondere aber den Wirt Marshall. Außerdem ist da noch Boo, ein Naturbursche, den die Forstbehörde geschickt hat, um einen Bären zu töten, der in der Region für Unruhe sogt.
Die Mütze als kathartisches Element
Die Handlung konzentriert sich hauptsächlich auf Marshalls Kneipe, in der zunächst die Paarbeziehungen geklärt werden: die junge, alleinerziehende Jill ist mit dem kaum älteren Erzähler Michael mehr oder weniger locker verbändelt. Aber auch der Kneipenwirt hatte Jill in früheren Zeiten in sein Wasserbett locken können. Jetzt kommt noch der Draufgänger Boo hinzu sowie auf der anderen Seite der Geschlechtergruppen Regina. Regina und ihre Mütze. Außerdem gibt es noch eine ganze Menge Statisten, die wenigstens teilweise an der Beziehungsschlacht teilnehmen. Und zwischen all dem taucht natürlich auch der Bär noch zweimal auf.
Lest das unbedingt selbst, es lohnt sich. Denn es geht wilder durcheinander als in Shakespeares Sommernachtstraum. Erst als in einer alkoholischen Neujahrsnacht Reginas Mütze verschwindet und darüber ein heftiges Scharmützel entsteht – und erst als der Bär erlegt ist, rücken die Dinge wieder an ihre angestammten Plätze.
Die Erzählung hat mich ziemlich schnell an meinen Lieblingsroman von Boyle erinnert, nämlich an Drop City, der zwölf Jahre später erschien und in seiner zweiten Hälfte in Alaska handelt. Und zwar mit einem ähnlich gelagerten gesellschaftlichen Schwerpunkt um Einheimische und Zugereiste wie in der Mützengeschichte. Fast zwanzig Jahre nach Die Mütze veröffentlicht Boyle übrigens eine weitere Episode aus dem fiktionalen Big Timber: Mein Schmerz ist größer als deiner.
★★★★★
8. — Bienenkönig
EN King Bee
Eines der gesellschaftlichen Probleme, das Boyle ganz offensichtlich immer wieder beschäftigt, ist das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Und zwar – wie von diesem Autor nicht anders zu erwarten – das gestörte Verhältnis! Ich erinnere mich an die Kurzgeschichte Die Form einer Träne (2022), die ich zuletzt vor einigen Wochen gelesen habe. Darin geht es um einen gewissen Justin, der sich nach dreißig Lebensjahren zu einem egomanischen Schmarotzer entwickelt hat und seine Eltern terrorisiert.
Die Geschichte um den Bienenkönig nähert sich auf einundzwanzig Buchseiten der gleichen Situation aus einem anderen Blickwinkel. Ken und Pat Mallow können keine leiblichen Kinder bekommen und adoptieren deshalb einen Waisenjungen. Allerdings ist Anthony zu diesem Zeitpunkt bereits neun Jahre alt und zeigt nach kurzer Zeit bei den Mallows eindeutig asoziales Verhalten, Hass gegenüber den Adotpiveltern und ein merkwürdiges monothematisches Interesse an Bienen. Die Situation eskaliert dann rasch: Anthony stiehlt, verletzt und vergewaltigt Mitschülerinnen; landet zunächst in der Psychiatrie und schließlich in einer Jugendhaftanstalt.
Doch dabei lässt es Boyle natürlich nicht bewenden. Denn als der junge Mann seine Strafe abgesessen hat, kündigt er schriftlich seine Racheabsichten an und erscheint schließlich leibhaftig mit einem ganzen Bienenschwarm vor dem Haus seiner Adoptiveltern. Den Rest malt Ihr Euch entweder selbst aus, oder Ihr lest die Geschichte.
Interessante Eltern-Kind-Verhältnisse
Es gibt noch eine weitere Geschichte in Boyles bisherigem Werk, die sich mit gebrochenen Generationsbeziehungen beschäftigt. Im Roman Hart auf Hart (2015) rebelliert Adam gegen seine Eltern und die Gesellschaft, die diese repräsentieren. In der damaligen Romanbesprechung schrieb ich: „Boyle kratzt mal wieder den Kitt aus den Fugen der Gesellschaft.“ Und genau das tut er auch in der Tränengeschichte von 2022 (siehe erster Absatz) und der deutlich düstereren Horrorerzählung um den Bienenkönig, die ja schon über dreißig Jahre alt ist.
Was übrigens in all diesen Geschichten gleich bleibt, ist der Unterschied zwischen Mutter-Sohn- und Vater-Sohn-Beziehungen bei T. C. Boyle. Während Väter irgendwann die Kommunikation zu ihren Kindern vollständig abbrechen und nur mehr die Bedrohung erkennen, die der Sprössling für sie darstellt, bleiben Mütter immer noch empathisch. Selbst gegen besseres Wissen und wenn sie sich dadurch in Gefahr begeben.
Die vorgliegende Geschichtensammlung hat T. C. Boyle übrigens seinen drei eigenen Kindern gewidmet, Kerrie, Milo und Spencer.
★★★
9. — Tauwetter
EN Thawing Out
Wie das damals so war in den Achtzigerjahren in den USA, erzählt uns Boyle in dieser Kurzgeschichte über achtzehn Seiten hinweg. Er serviert uns eine einfühlsame Story über verschiedene Lebenspläne und Erwartungen, über sehr unterschiedliche Kulturen und Familienverhältnisse. Im Kern der Erzählung stehen Naina und Marty aus New York, sie ist Unistudentin, er junger Lehrer an einer Sonderschule. Naina Vyshensky stammt aus einer ukrainischen Einwandererfamilie und pflegt herzlichen Umgang mit ihrer Mutter und deren Freunden aus der Ukraine. Marty hat längst keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter und ist hin und her gerissen zwischen Nainas Wunsch, ein gemeinsames Leben zu beginnen, und seinem eigenen Freiheitsdrang: Altes Europa mit überkommenen Werten gegen das freiheitliche Amerika? Sein Kumpel Terry überredet Marty schließlich, mit ihm nach Kalifornien zu gehen. Nainas Abschiedsfrage lautet: „Werde ich dir fehlen?“
Clash der Kulturen
Natürlich kommt, was kommen muss. Marty verliert den Kontakt zu Naina. Er lebt ein wildes Leben in San Francisco. Bis er nach einem halben Jahr merkt, dass das nicht das ist, was er wirklich will. Vielleicht zieht er auch die Reißleine, so genau erfahren wir das nicht. Jedenfalls kehrt Marty restlos abgebrannt ins kalte, vorweihnachtliche New York zurück. Seine Wohnung und sein Job sind weg. Seine Mutter will nichts davon wissen, ihren Sohn auch nur vorübergehend aufzunehmen.
Also macht sich Marty mit schlechtem Gewissen auf zu Nainas Mutter, Mama Vyshensky mit dem Damenbart. Die alte Dame hätte wahrlich jeden Grund, den treulosen Ex ihrer Tochter zum Teufel zu schicken. Doch warmherzig wie Mama ist, entscheidet sie sich dafür, ein Wiedersehen zu arrangieren – ausgerechnet beim Jahrestreffen des ukrainischen „Eisbärenclubs“ am Pier des Hudson Rivers. Wird Marty ins kalte Wasser springen?
★★★★
10. — Der Teufel und Irv Cherniske
EN The Devil and Irv Cherniske
In der zehnten Erzählung des Kurzgeschichtenbandes lässt T. C. Boyle auf zweiundzwanzig Seiten den Faust-Mythos auferstehen. Also diese ausgeschmückte Volkserzählung über Johann Georg Faust, der im sechzehnten Jahrhundert angeblich einen Pakt mit dem Teufel abschloss, und die zwei Jahrhunderte später bereits Johann Wolfgang von Goethe in seiner berühmten Tragödie Faust nacherzählte.
Bei Boyle ist Faust nun ein Anleihenhändler mit dem Namen Irv Cherniske, der die Teufelswette abschließt: Reichtum und Erfolg im Dieseits gegen seine Seele, die nach Irvs Tod bis in alle Ewigkeit in der Hölle brennen soll. Neue Erkenntnis oder gar unerwartete Wendungen birgt die Geschichte nicht. Immerhin ist sie aufgepeppt mit zeitgenössischen Bezügen zu Insiderhandel, Immobilien und Krügerrands. Und der Teufel befreit Irv sozusagen als Bonus auch gleich noch von seiner streitsüchtigen Ehefrau. Selbstverständlich versucht Irv Cherniske, dem Einlösen seines Versprechens zu entgehen, als sich seine Lebenszeit dem Ende entgegen neigt. Er lässt sich auf einen Ablasshandel mit der Kirche ein.
Bei Goethe verlor Faust seine Seele letztlich nicht an den Teufel. Der Pakt wurde nicht durch eine List, sondern durch Sinnhaftigkeit gebrochen. Mephisto unterlag, weil er das wahre Streben des Menschen nicht begreifen konnte. – Ob Boyles Cherniske dem ewigen Höllenfeuer auch entgeht? Was meint Ihr?
★★★
11. — Das Wunder von Ballinspittle
EN The Miracle at Ballinspittle
Hintergrundwissen: Ballinspittle ist ein real existierendes Dorf an der irischen Südküste. Der Ort hat keine vierhundert Einwohner und liegt etwa fünfunddreißig Straßenkilometer südlich der Hauptstadt der Grafschaft Cork. Im Sommer 1985 erregte Ballinspittle nationales und internationales Aufsehen, als Einwohner behaupteten gesehen zu haben, wie sich eine Statue der Heiligen Jungfrau Maria spontan bewegte. Als sich die Nachricht von diesem Phänomen verbreitete, strömten Tausende von Pilgern und Schaulustigen zum Standort der Statue. Viele Besucher behaupteten, spontane Bewegungen beobachtet zu haben. Der katholische Klerus in Irland nahm damals eine neutrale Haltung in Bezug auf die Echtheit der Behauptungen ein.
Aus dem Kult um die Blessed Virgin at Ballinspittle macht Boyle eine mystische Groteske, eine Massenerscheinung um die Läuterung und Himmelfahrt eines gewissen Davey McGahee. Zweihundertfünfzehn fassungslose Menschen werden in der Geschichte Zeugen, wie sich die Marienstatue von Ballinspittle McGahee zuwendet und ihm all seine Verfehlungen öffentlich vor Augen führt. Sie alle sehen die Fässer voll alkoholischer Getränke, die Davey bis dahin leergesoffen, alle Tiere, die er verzehrt hat, all die Frauen, mit denen er geschlafen oder die er auch nur begehrt hat, sowie alle anderen Sünden, mit denen der Mann sich und andere befleckt hat. Die Szene endet nach dreizehn Seiten in einer apolkalyptischen Endzeitszene, nach deren Kulmination Davey McGahee – o Wunder! – sich in Luft aufgelöst hat.
„Bis heute sieht die Stelle so aus wie in jener Nacht, gegen die Schaulustigen abgezäunt, von Priestern und Parapsychologen Zentimeter um Zentimeter durchkämmt, vom Papst gesegnet, ein ebenso verehrter Ort wie Lourdes oder der Heilige Stuhl selbst. […] Und dann sind natürlich die Touristenzahlen seit dem Wunder um satte 672 Prozent hinaufgeschnellt.“
(Seite 209 f.)
(Die Geschichte liste ich auch auf der Seite mit der Zusammenstellung von Boyles Erzählungen mit biografischem Charakter auf.)
★★
12. — Zapatos
EN Zapatos
Die mit acht Textseiten kürzeste Kurzgeschichte des Bandes trägt den spanischen Titel Zapatos | Schuhe. Sie handelt unverkennbar in Chile, auch wenn die Ortsnamen frei erfunden sind. In Chile also, wo die Korruption derartige Blüten treibt, dass reguläre Geschäfte ohne Trickserei längst ein Ding der Unmöglichkeit geworden sind. Boyle lässt einen jungen Mann namens Tomás von dessen Onkel „– nennen wir ihn Dagoberto –“ erzählen, einem Schuhhändler. Einem Schuhhändler der nichts mehr verkauft, weil er sich auf italienische Lederschuhe spezialisiert hat, die jedoch unerschwinglich geworden sind, weil die Importzölle in astronomische Höhe gestiegen sind.
Was also tun? Außer langsam zu verhungern? – Dagoberto hat sich etwas ausgedacht, wofür er die Hilfe seines Neffen braucht. Ein wirklich genialer Trick, den ich hier keinesfalls erklären werde, auch nicht unter Androhung von Folter. Lest selbst!
Politische Notiz am Rande: In den Jahren, als T. C. Boyle diese Geschichte geschrieben haben mag, also etwa Mitte bis Ende der 1980er-Jahre, befand sich Chile in einem Übergangsprozess von der Militärjunta zurück zur Demokratie. Diktator Agusto Pinochet hatte 1973 nach einem Putsch gegen die gewählte Regierung Salvador Allendes die Macht übernommen. Es gibt klare Hinweise darauf, dass damals die USA unter Präsident Nixon und seinem Sicherheitsberater Henry Kissinger den Militärputsch durch verdeckte Unterstützung bei Planung und Machtkonsolidierung unterstützten.
★★★★
13. — Die Affenfrau im Ruhestand
EN The Ape Lady in Retirement
Auf die kürzeste Geschichte des Sammelbandes folgt sogleich die mit fünfundzwanzig Seiten längste. Für meinen Geschmack ist es auch die herausragendste Kurzgeschichte dieser Sammlung. Es handelt sich um eine bizarre Persiflage auf die berühmte Primatenforscherin Jane Goodall, die bekannt für ihre Arbeit mit Schimpansen im Gombe-Nationalpark in Tansania ist, wo sie über Jahrzehnte hinweg das Verhalten der Tiere studierte. Sie revolutionierte die Primatenforschung, indem sie unter anderem nachwies, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen.
Beatrice Umbo
Viele dieser Details nimmt Boyle in seine Version der Geschichte auf. Nur heißt Jane bei ihm Beatrice und ist nach langen Jahren der Schimpansenforschung nach Connecticut zurückgekehrt, in den Ruhestand und in das Haus ihrer verstorbenen Mutter und Schwester. Sie adoptiert dort Konrad, einen ausgewachsenen Schimpansen, der bis dahin im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments in menschlicher Umgebung aufgezogen wurde.
Über die Jahre hat Konrad eine beklemmende Persönlichkeit irgendwo zwischen Affe und Mensch entwickelt. Sein Verhalten und seine körperliche Überlegenheit gegenüber Menschen provozieren teils Belustigung, teils Beunruhigung – sowohl unter den Figuren der Erzählung, als auch unter der Leserschaft. Wann immer Beatrice ihren Konrad in die Öffentlichkeit mitnimmt, entstehen humorige, aber auch stets brenzlige Situationen. Die Geschichte verdeutlicht die Unberechenbarkeit des menschlichen und tierischen Verhaltens und die Schwierigkeiten, die Kluft zwischen beiden zu überbrücken. Die vier letzten Seiten des Textes fragen wir uns: Kann es gut gehen, wenn Konrad Beatrice begleitet, als diese mit einem Bekannten einen Rundflug in einer Cessna unternimmt?
Primatenforschung à la Boyle
Das Thema beschäftigt den US-Autor immer wieder. Bereits zehn Jahre zuvor begann seine allererste Publikation mit der Geschichte Abstammung des Menschen, in der eine Primatenforscherin ihren Lebensgefährten verlässt, um mit einem Schimpansen in einer Forschungsstation zusammenzuleben. Und gut drei Jahrzehnte später spielt im Roman Sprich mit mir der Schimpanse Sam die Hauptrolle. Darin vertieft Boyle die Problematiken, die er bereits in Abstammung des Menschen und Die Affenfrau im Ruhestand angerissen hat.
★★★★★
14. — Wenn der Fluss voll Whiskey wär
EN If the River Was Whiskey
„Wenn der Fluss voll Whiskey wär,
dann bräucht ich keinen kaufen;
ich könnte dann ’ne Ente sein
und tät beim Schwimmen saufen.“
(Seite 250)
Die Titelgeschichte des gesamten Bandes ist eine szenische Erzählung aus der Sicht zweier Personen. Sie spielt an ein paar Tagen eines Sommerurlaubs am Fluss, den der heranwachsende Junge Tiller zusammen mit seinen Eltern verbringt. Die beiden Erzähler sind Tiller selbst und sein namenloser Vater. Für den Jungen stehen die sonnigen Tage beim Hechtangeln im Vordergrund. Aber auch seine erwachende Sexualität kommt zur Sprache. Auf der anderen Seite stehen die Eltern, die nichts mehr vom Leben erwarten. Der Vater hatte einstmals in einer Band Gitarre gespielt, doch nun sind seine Träume zerplatzt. Seinen Job hat er verloren, er verbringt seine Tage am Tropf mit Wodka und Soda. Mit seiner Ehefrau Caroline ist er an einem Punkt der Beziehung angelangt, der über Streit längst hinüber ist. Da ist bloß mehr gegenseitige Verachtung übrig. Und auch Caroline trinkt viel zu viel.
Einen Anlauf zur Rückkehr in ein Familienleben unternimmt der Vater noch. Auch wenn es ihn ungeheure Überwindung kostet, bleibt er einen ganzen Tag über abstinent und unternimmt mit Tiller einen Angelausflug zu dessen Lieblingsfanggrund am Fluss. Doch die Partie endet für beide enttäuschend, der letzte Versuch ist gescheitert.
Wenn man sich daran erinnert, dass Boyle im Haushalt alkoholkranker Eltern aufwuchs, bekommt die Erzählung, die sich über zweiundzwanzig Seiten erstreckt, einen beklemmenden Beigeschmack. Schreibt der Autor da etwa seine eigenen Erinnerungen auf?
★★★★
~
Wer die Besprechungen dieser Erzählungen gern gelesen hat, interessiert sich vielleicht auch für alle anderen Kurzgeschichtenbände und Romane von T. C. Boyle, die ich im Rahmen eines umfangreichen Autorenprofils vorstelle.
Fazit:
Soviel ist klar, dieser dritte Band von Kurzgeschichten des US-Autors T. C. Boyle ist ganz sicher einer, den ich irgendwann wieder aus dem Regal ziehen werde. Auch wenn ich zwei der Erzählungen nicht sonderlich überzeugend finde. Denn immerhin sind auch acht weit überdurchschnittliche Geschichten dabei, von denen ich sogar zwei mit der Höchststernezahl bewertet habe. Da ist es kein Wunder, dass die Sammlung bei insgesamt vier von fünf möglichen Sternen landet. (Dies ist bei Sammelbänden eher ungewöhnlich. Die landen fast ausnahmslos in der Mitte bei drei Sternen, völlig unabhängig vom Autor.)
Boyle beweist in Wenn der Fluss voll Whiskey wär einmal mehr sein Gespür für scharfsinnige Beobachtungen und skurrile Figuren. Mit schwarzem Humor erzählt er von den Bruchstellen menschlicher Existenzen. Fast jeder der Texte überrascht, berührt – und bleibt lange im Gedächtnis.
T. C. Boyle, If the River Was Whiskey
| Wenn der Fluss voll Whiskey wär
EN Viking, 1989
DE Deutscher Taschenbuchverlag, 1991
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)