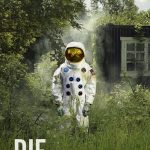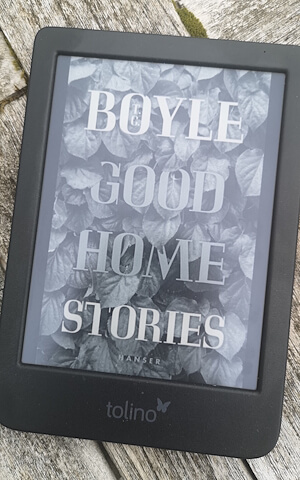
Der Carl Hanser Verlag veröffentlichte im Jahr 2018 einen Kurzgeschichtenband des US-Autors T. C. Boyle, der zuvor nicht in dieser Zusammensetzung in den USA erschienen war. Wenn man allerdings genauer hinsieht, erkennt man, dass die einzelnen Erzählungen in Good Home aus verschiedenen früheren, englischsprachigen Sammelbänden übernommen und übersetzt wurden. Good Home wurde hierzulande ein Jahr nach dem Boyle-Roman Die Terranauten sowie ein Jahr vor Das Licht auf den Buchmarkt geworfen. Die zwanzig Geschichten der Sammlung entstanden in den Nullerjahren. Einmal mehr sind Boyles Protagonisten die Außenseiter, die Unglücklichen und Vernachlässigten der Gesellschaft, die nichts auf die Reihe kriegen. Die Figuren bewegen sich in einer Welt, in der menschliche Nähe brüchig geworden ist. Einsamkeit durchzieht ihre Existenz wie ein Grundton, während Solidarität in Momenten der Krise ausbleibt. Verantwortung wird abgegeben, Beziehungen verlieren sich in einem Geflecht aus Täuschung, Missverständnissen und unausgesprochenen Erwartungen.
Über die Kurzgeschichten
Zwanzig Erzählungen in einem Band, das ist eine Hausnummer, eine Herausforderung. Ich greife einmal diejenigen acht Geschichten heraus, die mich besonders beeindruckt haben. Darin geht es gleich zu Anfang um den Einfluss, den ein alkoholabhängiger Vater auf seine heranwachsende Tochter ausübt. Es geht um die Schlacht zwischen Kreationisten und Naturwissenschaftlern, um eine ungewöhnliche Geiselerpressung in Venezuela und um Brandstiftung in Kalifornien. Schließlich ereignet sich das Wunder der Musik in einem schäbigen Aufnahmestudio und wir kehren nach Big Timber zurück, wo sich diesmal ein Stalker herumtreibt. Wir folgen einer Familiensaga am Hudson River und wir begleiten gegen Ende hin in der titelgebenden Geschichte Good Home einen Kampfhundezüchter durch seine finsteren Stunden.
Die gute Nachricht ist, dass die anderen zwölf Kurzgeschichten alles andere als schwach sind und anderen Lesern als mir wahrscheinlich sogar besser gefallen werden, als die von mir hier oben angerissenen. Findet es für Euch heraus!
~
1. — Balto
EN Balto
Wir starten mit einem von Boyles Lieblingsthemen, nämlich dem Alkohol. Genauer gesagt mit Alkoholmissbrauch und den Konsequenzen, die er unweigerlich mit sich bringt. Im Zentrum dieser ersten Kurzgeschichte von zweiundzwanzig Textseiten stehen Alan und seine Tochter Angelle. Die beiden fungieren abwechselnd als Erzähler, und ich muss sagen, es ist eindrucksvoll, wie der Autor die beiden Figuren und ihre so unterschiedlichen Blickweisen darstellt.
Vater und Tochter
Alan hat seine besten Jahre hinter sich, arbeitet hart, vielleicht zu hart und trinkt viel, mit Sicherheit zu viel. Seine französische Ehefrau hat ihn offenbar verlassen, doch inzwischen hat Alan eine Affaire mit einer jungen Asiatin. Die Restfamilie – zwei Töchter, Angelle und Lisette, sowie Vater Alan – leben in Kalifornien, in irgendeiner Stadt am Meer. Finanziell geht es ihnen gut, ein Au-pair und ein Hausmädchen kümmern sich um die Mädchen. Eine Vorzeigefamilie mit alleinerziehendem Vater, wenn da nicht die Alkoholsucht Alans wäre.
Die ältere Tochter Angelle ist zwölf und sie weiß ganz genau, was mit ihrem Vater los ist. Wie T. C. Boyle dieses Mädchen skizziert, das gehört zum Besten, was ich bislang von ihm gelesen habe. Präzise und unerbittlich arbeitet er die widersprüchlichen Empfindungen heraus, die Angelle ihrem Vater entgegenbringt: Wie er vom unumstrittenen Held ihrer frühen Kindheit langsam zum unkontrollierten Verlierer wurde. Welche Zweifel sie an ihrem Vater hegt, die doch eigentlich schon so gut wie Gewissheiten sind.
In der Handlung der Geschichte geht es um einen Unfall. Alan hatte sich wieder einmal seit Mittag volllaufen lassen und darüber fast die beiden Töchter vergessen, die vor der Schule auf ihn warteten. Nachdem Alan Angelle und Lisette endlich abgeholt hat, fahren sie auf dem Heimweg einen jungen Mexikaner auf seinem Fahrrad an. Nichts Dramatisches, eher eine Bagatelle, die sich finanziell leicht regeln lassen würde. Doch die zentrale Frage vor Gericht lautet: Wer saß da eigentlich am Steuer von Alans Wagen?
Ein Text wie ein Abgrund und mit einem bitterbösen Ende.
★★★★
2. — La Conchita
EN La Conchita
Hintergrundwissen: La Conchita ist eine existierende Gemeinde mit weniger als vierhundert Einwohnern an der kalifornischen Küste zwischen Los Angeles und Santa Barbara. Der Ort wird durch den Highway 101 vom Strand getrennt. Im Januar 2005 begrub nach heftigen Regenfällen ein Erdrutsch einen Teil der Ansiedlung. Es gab mehrere Tote in La Conchita, die Schlammmassen blockierten den Highway.
Boyle erzählt die Naturkatastrophe in Form eines Zeugenberichts nach. Sprecher in seiner Version der Geschichte ist Gordon, ein Berufskraftfahrer, ein Bote, der mit seinem Lieferwagen terminkritische Ladungen ausliefert. An diesem Tag transportiert er eine menschliche Leber vom Flughafen in Los Angeles zum Krankenhaus in Santa Barbara. Doch Gordons Wagen bleibt wie alle anderen auch im Schlamm auf Höhe von La Conchita stecken. Und mit einem Mal findet sich der Erzähler mitten in der Ortschaft wieder, wo er Seite an Seite mit anderen verzweifelt versucht, Verschüttete aus den Trümmern der Häuser auszugraben. Was wird derweil aus dem Transplantationsorgan in seinem Wagen?
Eine dramatische Geschichte über nur fünfzehn Seiten, die ich in der Liste von Erzählungen mit biografischem Charakter verlinke. Die Schlammlawine von 2005 war übrigens nach 1995 bereits die zweite, die La Conchita verwüstete. Und es gibt keinen Grund zur Hoffnung, dass der Ort nicht weiterhin von Erdrutschen betroffen sein wird. (Quelle: Wikipedia EN)
★★★
3. — Frage 62
EN Question 62
Die Hausfrau Mae bekämpft gerade Schnecken in ihrem Garten in Südkalifornien, als eines Morgens ein Tiger am Rande ihres Grundstücks auftaucht. In der Zwischenzeit kümmert sich Maes Schwester Anita im Norden der USA, bei den großen Seen, um ein paar verwilderte Katzen unter ihrem Wohnwagen. Sie vermisst ihren verstorbenen Ehemann und versucht, eine Beziehung mit Todd aufzubauen, einem Nachbarn, der sich für eine Wahlkampagne einsetzt, die es Menschen erlauben soll, streunende Tiere zu töten. Mae und Anita sind seit der Highschool Vegetarierinnen, aber sie lernen immer noch dazu, wenn es darum geht, sich um Tiere zu kümmern; sowohl um wilde als auch um menschliche.
Absurde Szenen im Wechsel aus Kalifornien und Wisconsin, verteilt auf einundzwanzig Buchseiten – manchmal kaum zu glauben, dann wieder so anrührend, dass man den Figuren am liebsten beiseite springen möchte. Tatsächlich bewegt sich die ganze Geschichte über kaum etwas. Aber dem Autor gelingt es wieder einmal meisterlich, eine Erzählung um so gut wie nichts in einen großen Zusammenhang einzuspannen: in die Zerstörung der Umwelt, um den Umgang des Menschen mit anderen Spezies auf dem Planeten, um Beziehungen und Krisen sowie über unglaubliche Zufälle.
Frage am Rande: Wenn sich die Wahlkampagnenfrage 62 mit dem Umgang mit Streunern befasst, um was geht es dann bei Frage 1? Etwa um die Ausrottung der Indianer?
★★★
4. — Sin Dolor
EN Sin Dolor
Wir begeben uns in ein namenloses Städtchen in der Nähe der mexikanischen Millionenstadt Guadalajara und lauschen der Erzählung eines dort praktizierenden Allgemeinmediziners. Dieser Arzt bringt als Geburtshelfer den Sohn von Francisco und Mercedes Funes zur Welt, Dámaso. Über die folgenden Jahre taucht der Junge immer wieder in der Arztpraxis auf, mit Narben und frischen Verletzungen, so dass der Doktor schon den Verdacht auf Kindesmisshandlung hegt. Tatsächlich aber liegt der Fall anders. Denn Dámaso hat kein Schmerzempfinden. Wenn er in glühende Kohlen greift, verbrennen seine Hände. Wenn er vom Dach stürzt, bricht er sich das Bein. Aber der Junge spürt nichts davon. Alle im Ort nennen ihn nur „Sin dolor“ – den, der keinen Schmerz kennt.
Der Arzt interessiert sich für Dámaso, weil er sich womöglich eine medizinische Sensation verspricht. Er versucht, sich mit dem Jungen anzufreunden. Und der fasst auch Vertrauen zum Doktor. Doch der Vater Francisco hat andere Pläne mit seinem Sohn. Er verkauft Dámasos unbegreifliche Schmerzlosigkeit als Jahrmarktsattraktion an den Straßenecken. Wird es dem Doktor gelingen, den mittlerweile schwer gezeichneten Jungen aus dem erbarmungslosen Familienclan zu befreien? Oder gibt es doch einen Schmerz, den Dámaso spürt? Nicht außen, an seinem geschundenen Körper, sondern in seinem Inneren?
Eine erschreckende Geschichte über Armut, Familiengehorsam und Unmenschlichkeit, die uns Boyle auf einundzwanzig Textseiten erzählt.
★★★
5. — Hieb- und stichfest
EN Bulletproof
„Die in diesem Buch vorgestellte Evolutionstheorie ist lediglich eine Theorie und sollte nicht als Tatsache aufgefasst werden.“
Dieser Satz ist Auslöser eines Dramas in sieben Akten, das uns Boyle in seiner fünften Kurzgeschichte präsentiert. Die Worte stehen auf einem Aufkleber auf dem Einband eines Biologiebuches, das ein Freund dem Erzähler der Geschichte, Calvin Jessup, zeigt. In der Schule seiner Tochter sei ein Streit über den Aufkleber entbrannt zwischen Kreationisten und Naturwissenschaftlern.
Obwohl Calvin selbst kinderlos ist, gerät er zwischen die Fronten des schulischen Elementarkampfes. Denn zum einen hat er mit Religion nichts am Hut und ist persönlich von der Evolutionstheorie überzeugt. Aber andererseits lernt er eine junge geschiedene Frau und deren Tochter kennen, die beide felsenfest an die wörtliche Auslegung der Bibel glauben. Cal verliebt sich und steckt in der Zwickmühle.
Dem Autor gelingt es in dieser dreiundzwanzigseitigen Erzählung zum einen, die ganze unversöhnliche Wucht aufzuzeigen, mit der Menschen zutiefst gegenläufiger Überzeugungen aufeinanderprallen. Religiöse Eiferer gegen wissenschaftliche Hardliner. Doch im Kern ist T. C. Boyle kein Spalter. Und so endet sein Drama in einer leisen Szene, in der beide Denkansätze nebeneinander stehenbleiben können, ohne dass es zum Eklat kommt.
Hintergrundwissen:
In den Jahren 2004 und 2005 wurde vor einem United-States-Gerichtshof im Bundesstaat Georgia eine Klage EN verhandelt, in der Schülereltern die Schulbehörde im Cobb County aufforderten, einen Aufkleber von Biologiebüchern zu entfernen, auf dem zu lesen war: „Evolution is a theory, not a fact, concerning the origin of living things.“ Im Dezember 2006 verkündete der Gerichtshof, es habe eine außergerichtliche Einigung gegeben, in der die Schulbehörde sich verpflichtete, auf Hinweise gegen die Evolutionstheorie zu verzichten.
★★★★
6. — Hände
EN Hands On
Zwischen vierzig und fünfzig Prozent aller US-amerikanischen Ehen werden geschieden. Geschiedene, gut situierte Frauen mit viel Zeit und zu wenig Beschäftigung gehören deshalb zum Bild der upper class. In seiner sechsten Kurzgeschichte mit nur zehn Seiten Umfang lässt T. C. Boyle eine namenlose Fünfunddreißigjährige aus ihrem Leben erzählen. Über ihr viel zu großes, ungemütliches Haus, über ihre wachsende Unzufriedenheit mit ihrem Körper, über ihre Einsamkeit, die sie mit Alkohol betäubt.
Natürlich landet die Erzählerin in der Praxis eines Schönheitschirurgen und ist fasziniert von den warmen, weichen Händen des Mannes. Ich habe mir die Frage gestellt, was andere Autoren aus diesm Setup wohl gemacht hätten: Eine Liebegeschichte? Einen One-Night-Stand? Irgendeine andere Peinlichkeit, die sich im Leben einer frustrierten Frau ohne Ziele abspielen könnte? – Wie nicht anders zu erwarten, treibt Boyle die Geschichte auf die Spitze. Bei ihm verliert die Frau nicht nur Urteilsvermögen und Kompass. Die Situation in der Praxis des Chirurgen eskaliert.
★★★
7. — Die Lüge
EN The Lie
Die meisten von uns kennen das: Der Job ist Mist, der Haushalt und die Familie überfordern uns, das Leben scheint an uns vorüberzugehen. In einer solchen Situation ist es doch verständlich und im Grunde ganz einfach, wenigstens einmal auszubrechen, nur für einen einzigen Tag, nur um endlich Atem zu holen, um Kraft zu schöpfen. Am Tag darauf würde es dann schon wieder gehen, irgendwie.
Lonnie und Clover, beide um die dreißig, sind verheiratet und haben eine Tochter mit neun Monaten. Dann kommt dieser Tag, an dem Lonnie das Baby bei der Tagesmutter abliefert. Aber statt danach wie sonst ins Büro zu fahren, ruft er dort an. Er erzählt eine Notlüge, das Kind sei schwer krank. Lonnie verbringt tatsächlich einen unbeschwerten Tag. Und weil das doch so einfach war, telefoniert er am nächsten Tag noch einmal mit seinem Boss: Er könne wieder nicht zur Arbeit kommen, denn – um Himmels Willen! – das Baby sei plötzlich verstorben. Von dieser verheerenden Lüge kann sich Lonnie nicht mehr befreien. Beileidsbekundungen gehen ein, Geldspenden seiner Kollegen. Und die vermeintliche Familienkatastrophe macht natürlich die Runde.
Auf siebzehn Buchseiten treibt uns der Autor immer tiefer hinein in das Dilemma eines armen Wichts, der sehenden Auges mit einer unüberlegten Lüge sein ganzes Leben in den Abgrund stürzt.
★★★
8. — Die unglückliche Mutter von Aquiles Maldonado
EN The Unlucky Mother of Aquiles Maldonado
Marita Villalba ist in ihrem venezolanischen Heimatort Caracas eine angesehene Persönlichkeit, und das nicht nur, weil ihr Sohn Aquiles Maldonado erfolgreicher Baseballwerfer der American League in den Vereinigten Staaten ist. Doch als alle Zeitungen über eine millionenschwere Vertragsverlängerung ihres berühmten Sohnes berichten, wird Marita von einer Guerillabande als Geisel in den Dschungel entführt, um Lösegeld zu erpressen. Aquiles lässt in Baltimore alles liegen und stehen, eilt zurück nach Venezuela. Der Polizeichef rät ihm, auf keinen Fall zu bezahlen, sondern abzuwarten. Doch Aquiles hat andere Möglichkeiten, seine Mutter zu befreien.
Eine humorig komponierte Erzählung mit durchaus ernsten Hintergründen: Es geht um den Wert der Familie, um die wirkliche Bedeutung von Reichtum; aber auch um die aberwitzigen Gegebenheiten in mittelamerikanischen Staaten. Diese zwanzigseitige Geschichte Boyles ist ein echtes literarisches Kleinod.
★★★★
9. — Admiral
EN Admiral
Der „Admiral“ in dieser Kurzgeschichte ist weder ein deutsches Automodell noch ein Marineoffizier, ein Schmetterling oder ein Cocktail. Vielmehr handelt es sich um den afghanischen Windhund des Ehepaares Gretchen und Cliff Striker. Die Strikers sind Millionäre und hatten für ihren über alles geliebten Admiral eine Hundesitterin eingestellt, Nisha. Vier Jahre lang kümmerte sich Nisha jeden Tag um den Afghanen, bis sie eines Tages kündigte um am College zu studieren.
Einige Jahre später kehrt Nisha nach Hause zurück, um ihr schwerkranke Mutter zu pflegen. Überraschend kontaktieren die Strikers die junge Frau. Denn nachdem ihr geliebter Admiral vom Auto überfahren worden war, hatten die beiden für eine satte Viertelmillion Dollar einen Klon des toten Tieres züchten lassen. Admiral II soll nun haargenau so aufwachsen, wie sein Genspender. Deshalb darf keine andere als Nisha die Klonsitterin werden.
„Kriege wurden geführt, Menschen starben vor Hunger, es waren Krankheiten zu besiegen und Kinder zu erziehen, es gab viel Gutes zu tun in der Welt, und sie war hier und durchlebte in Gesellschaft eines geistig leicht zurückgebliebenen Clowns von einem geklonten afghanischen Windhund abermals ihre Jugend, weil zwei kinderlose reiche Leute es so beschlossen hatten. Na gut.“
(Seite 167)
Was macht Boyle auf seinen zweiundzwanzig Buchseiten aus dieser ohnehin verrückten Ausgangslage? Er schleust ein subversives Element ein, einen jungen Mann, der sich als europäischer Journalist ausgibt und mit Hilfe von Nisha die groteske Idee des Hundeklonens ad absurdum führen möchte. Ob das wohl gut geht?
★★★
10. — Aschermontag
EN Ash Monday
Wenn die heißen, trockenen Santa-Ana-Winde durch die südkalifornischen Canyons fegen, steigt die Feuergefahr. Das wissen auch die Figuren in Boyles zehnter Geschichte. Die beiden Erzähler sind Nachbarn: Der dreizehnjährige Dill wohnt mit seiner Mutter am Ende eines Canyons, direkt neben Sanjuro und Setsuko Yukiguro, einem japanischen Ehepaar. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis besteht nicht gerade zwischen Dill und Sanjuro. Der Junge bedenkt seinen asiatischen Nachbarn mit rassistischen Schimpfwörtern. Und der Japaner entsetzt sich über die Unvernunft Dills, der Abend für Abend den Holzkohlegrill mit Benzin befeuert und dabei einmal um ein Haar das strohtrockene Gras in Brand gesteckt hätte.
Die Brandkatatstrophe liegt die ganzen zwanzig Textseiten der Geschichte über in der Luft, zum Greifen nahe. Es kann ja gar nicht anders kommen, als dass dieser aufsässige, verantwortungslose Dill die ganze Gegend abfackeln wird! – Aber dann geschieht doch etwas ganz anderes.
Ich mag ja diese subtilen Geschichten T. C. Boyles sehr gerne. Geschichten, in die der Autor mehrere Themen verpackt oder verstrickt. Hier haben wir natürlich oberflächlich die dramatische Brandgefahr in Südkalifornien. Aber daneben erleben wir mit Dill das Heranwachsen ohne Vater oder auch nur Ersatzvater. Und wir bekommen einen Einblick in die Gedankenwelt und das Leben japanischer Expats in den USA. Außerdem wird – wie üblich – wieder heftig gebechert in dieser Erzählung, mit der wir die Hälfte des Sammelbandes erreicht haben.
★★★★
11. — Dreizehnhundert Ratten
EN Thirteen Hundred Rats
Frage: Was ist wohl der Unterschied zwischen Hunden und Ratten? – Antwort: Hunde sind die besten Freunde des Menschen, Ratten sind „Schädlinge, Ungeziefer, Feinde des Menschen, die man ausrotten, nicht aber hegen und pflegen sollte“ (Seite 214). Aber ist das wirklich so? Gerard Loomis ist nach dem Tod seiner Frau vereinsamt und verwahrlost sowie letztlich im wahrsten Sinn der Worte „auf die Ratte gekommen“. Als gegen Ende von nur sechzehn Textseiten Nachbarn die Feuerwehr benachrichtigen und das Haus aufgebrochen wird, strömen hunderte von Ratten aus dem Gebäude, in dem die Leiche Gerards gefunden wird.
T. C. Boyle ist bekanntlich ein großer Natur- und Tierfreund. Er selbst wird auf täglichen Wanderungen fast immer von seiner Hündin Ilka begleitet. Ratten in seinem Garten fängt er in einer Käfigfalle und entlässt sie weit draußen in der Natur in die Freiheit. Die explosionsartige Vermehrungsfähigkeit von Ratten scheint ein Faszinosum für den Autor zu sein. Denn schon 2012 hatte er in seinem Roman Wenn das Schlachten vorbei ist über die Rattenplage auf der Insel Anacapa geschrieben.
★★
12. — Anacapa
EN Anacapa
Nur ein paar Zeilen weiter oben habe ich die kleine kalifornische Vulkaninsel Anacapa vor Oxnard im Zusammenhang mit einer historischen Rattenplage erwähnt. Hier in der zwölften Kurzgeschichte spielt Anacapa allerdings lediglich eine winzige Statistenrolle, nämlich als malerischer Hintergrund während einer touristischen Angeltour, die der Erzähler Hunter und sein Kumpel Damian unternehmen. Die Story beginnt morgens im Hafen nach einer durchzechten Nacht, schlingert dann durch Unmengen von Details während der Fangfahrt, Geschichtchen in der Geschichte, und endet abends an der Bar eines Fischrestaurants. Oder genauer gesagt in der Toilette des Restaurants, in der Hunter – nach 20 Buchseiten – einen Zusammenbruch erleidet.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so ratlos bin?
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
(frei nach Heinrich Heine)
★★
13. — Drei Viertel des Wegs zur Hölle
EN Three Quarters of the Way to Hell
Zwei abgehalfterte Musiker sind in New York City auf dem Weg ins Aufnahmestudio, um dort ein paar schnulzige Weihnachtslieder aufzunehmen. Johnny Bandon ist ehemals erfolgreicher Schlagersänger, Darlene Delmar hat es nie aus der Zweitklassigkeit nach oben geschafft. Die Umstände sind katastrophal, auf den Straßen schneit und graupelt es. Bei Darlene ist zu Hause die Heizung ausgefallen, sie laboriert an einem Tripper, den ihr irgendein Kerl angehängt hat. Johnny braucht Alkohol und Joints, um auf Touren zu kommen. Im heruntergekommenen Studio treffen die beiden dann aufeinander, witzeln über die Vergangenheit und ergehen sich insgeheim in den Makeln, die sie beim jeweils anderen wahrnehmen.
„»Ich schätze, die Hälfte des Weges zur Hölle haben wir schon hinter uns«, sagte sie. »Ach, ich weiß nicht«, sagte er. […] Eher drei Viertel würde ich sagen.« Und dann lachten sie wieder, zweistimmig.“
(Seite 246)
Doch dann, bei der Aufnahme, ereignet sich das Wunder: Trotz aller Widrigkeiten harmonieren Darlene und Johnny auf geradezu magische Weise. – Eine Ode an die Kraft der Musik, die Boyle da auf fünfzehn Seiten wortgewaltig komponiert.
★★★★
14. — Mein Schmerz ist größer als deiner
EN My Pain Is Worse Than Your Pain
Erinnert sich jemand an die Boyle-Geschichte Die Mütze? Die ist mindestens drei Jahrzehnte alt und handelt in der kalifornischen Sierra Nevada, in einem erfunden Bergdorf namens Big Timber. Dort, wo es damals um die zentrale Frage ging, wer gerade mit wem schläft. Um Beziehungskisten auf 2.000 Meter Meereshöhe. Nun, hier und heute kehren wir nach Big Timber zurück. Und wen wundert es, dass es auch diesmal um Zwischenmenschliches geht?
T. C. Boyle nimmt uns diesmal mit in die neunzehnseitige Ich-Erzählung eines der Männer aus Big Timber, dessen Name aus der Geschichte nicht hervorgeht. Der Kerl ist zwar verheiratet, stellt aber trotzdem seiner verwitweten Nachbarin Lily nach. Wir würden es zweifellos Stalking nennen. Aber der Erzähler lässt sich durch nichts davon abbringen, sich dem Objekt seiner Begierde immer wieder zu nähern. Nicht durch einen Sturz vom Dach von Lilys Hütte; nicht durch die Erniedrigung, als ihn das ganze Dorf dort im Schnee liegen sieht; nicht durch die Scheidung, die seine Frau einreicht; und erst recht nicht durch die unmissverständliche Zurückweisung durch Lily selbst.
Dramatische Schmonzetten
Rund um die liebeswütigen Dauerbelästigungen legt der Autor einen wilden Dschungel von Geschichten in der Geschichte an. Darin geht es zum Beispiel um den schaurigen Tod in der Wildnis von Lilys Mann Frank, um einen Haushaltsunfall Lilys selbst, bei dem sie sich mit siedendem Frittieröl verbrannte. Oder um die herzzerreißende Leidensgeschichte eines Einbrechers, der nur deshalb auf Abwege geraten sein will, weil er als Kind einem Pädophilen als Sklave dienen musste. Oder um Lilys einarmigen Stiefsohn Frank jr., der einst angeblich bekifft einen Eisbären im Zoo provoziert hatte, der ihm den rechten Arm bis zur Schulter abgerissen haben soll. (Diese letzte Episode nimmt Boyle übrigens in seiner Kurzgeschichte Hell lodernd detaillierter auf.)
Ich denke, ich kann mir erparen, Einzelheiten zum übermäßigen Alkoholkonsum in und um Big Timber aufzuführen. Was ich aber weder mir noch Euch ersparen kann, ist der Hinweis darauf, wie viel Lesespaß mir diese zweite Folge aus der Seifenoper in den kalifornischen Bergen gemacht hat – Big Timber oder: Wer ist das ärmste Schwein im Dorf?
★★★★
15. — Das Schweigen
EN The Silence
Ein Schweige-Retreat im Sinne eines buddhistischen Rückzugs in die Stille hat den Sinn, inneres Erleben zu vertiefen, mentale Klarheit zu fördern und zurück zur eigenen Mitte zu finden – durch bewussten Verzicht auf äußere Ablenkung, insbesondere durch Sprache, Medien und soziale Interaktion. Wo der Buddhismus im Westen angekommen ist, finden sich immer mehr Menschen, die auf der Suche nach alternativen Werten bereit sind, ihr bisheriges Leben umzukrempeln und sich nach entsprechender Erleichterung ihrer Geldbeutel der Anleitung durch spirituelle Führer anzuvertrauen.
Die fünfzehnte Kurzgeschichte T. C. Boyles erstreckt sich über nur siebzehn Seiten und nimmt uns mit in die Wüste von Arizona, wo sich ein gewisser Ashoka zusammen mit dreizehn Gleichgesinnten für die nächsten drei Jahre, drei Monate und drei Tage in ein Schweige-Retreat begibt. Unter Anleitung von Geshe Stephen und Lama Katie, mit möglichst keinem Kontakt zur Umwelt und auf jeden Fall ohne sprachliche Kommunikation – auch dann nicht, wenn man sich an einem heißen Topf die Finger verbrennt oder wenn eine Klapperschlange in der Wohnhütte auftaucht. „Ashoka“ heißt bürgerlich Jeremy Clutter, ist dreiundvierzig, lernte nach der Scheidung von seiner ersten Frau die vierzehn Jahre jüngere Sally kennen, heiratete erneut und taucht nun mit seiner „Karuna“ in die Klarheit und Ruhe der buddhistischen Lehre ein.
Subtile Demontage
Boyle ist ein Meister darin, sich feinsinnig über Menschen lustig zu machen, deren Ziele er für unrealistisch hält. Nämlich immer dann, wenn seine Erzählungen so überhaupt keine Komik aufweisen, sondern besonders objektiv beschreibend und empathisch werden, ist unsere Aufmerksamkeit gefordert. Man muss dann wirklich sehr genau hinsehen, um mitzubekommen, wie der Autor seine Protagonisten ad absurdum führt.
Hier beginnt die Demontage schon mit den buddhistischen Titeln der beiden spirituellen Leiter. Denn wenn man ein wenig recherchiert, wird rasch klar, dass ein Geshe, also ein tibetischer Mönch, keine weibliche Gefährtin haben wird; und dass diese Gefährtin keinesfalls den männlichen Titel Lama tragen kann. Aber das muss die Leserschaft schon selbst herausfinden. Offener zu Tage tritt der Spott des Autors, wenn Stephen oder Katie ihren Schützlingen Aufgaben zuteilen, dabei aber an den kommunikativen Regeln scheitern. Denn sprechen dürfen sie nicht, pantomimische Befehlsübermittlung scheitert, also schreiben sie Anweisungen auf – im Widerspruch zum Sinn des Schweige-Retreats, nämlich in wirkliche, absolute Stille einzutauchen. Vollkommen absurd wird es, wenn der schweigende Ashoka alias Jeremy mitten in der Wüste den familienrechtlich vorgesehenen Besuch seiner Ex-Frau und der beiden gemeinsamen Söhne bekommt. Geht’s noch?
In fünfzehn kurzen, einseitigen Kapitelchen begleiten wir das spirituelle und menschliche Scheitern Jeremy Clutters. Dass zu seiner Bruchlandung die grausame Unerbittlichkeit der Natur wesentliche Beiträge liefert, überrascht natürlich nicht. Denn genau dies ist ja eines der boyleschen Mantren.
★★★
16. — Tod in Kitchawank
EN A Death in Kitchawank
Ich sag es vorab: Dieser vierundzwanzigseitige Tod in Kitchawank ist die Kurzgeschichte des Bandes, die mich am meisten beeindruckt hat. Es handelt sich um eine Familiensaga rund um die Haupterzählerin Miriam, ihren Mann Sid, die beiden Söhne Alan und Lester sowie die Tochter Susan. Die Familie ist Teil einer jüdischen Kolonie in der fiktiven Ortschaft Kitchawank, die vermutlich an einem der Seen im Hudson Valley liegen soll. Die Kitchawank-Kolonie wurde übrigens bereits in Boyles Roman World’s End erwähnt, dort als Wohnort von Walter van Brunt. Die Erzählung wurde erstmals im Jahr 2010 in The New Yorker veröffentlicht.
Zeitrahmen
Wenn man der Familiengeschichte einen zeitlichen Rahmen zuordnen will: Man kann sich aus einzelnen Szenen ausrechnen, dass Miriam Anfang bis Mitte der Zwanzigerjahre geboren sein muss, ihr Mann Sid drei Jahre vor ihr.
Miriams Erzählung setzt ein an einem Julisamstag Anfang der Siebzigerjahre, wahrscheinlich 1971, und zieht sich bis in die Neunzehnachtzigerjahre hinein. Sie gibt Episoden aus all diesen Jahren wieder, Episoden aus dem Leben der Familienmitglieder Miriams, ihrer besten Freundin Marsha, deren Mann David und der Tochter Seldy. Auch wenn ich im ersten Absatz von einer Familiensaga gesprochen habe und auch wenn das natürlich vollkommen richtig ist, könnte man auch vom Portrait der Menschen einer Generation sprechen. Ein Portrait der US-amerikanischen Kriegs- und Nachkriegsgeneration.
Ein erzählerisches Detail am Rande darf nicht unerwähnt bleiben: Zwischen Miriams Episoden, die in der dritten Person erzählt werden, gibt es immer wieder Texteinschübe in der Ich-Form eines gewissen T. Dieser T. ist der beste Freund von Miriams Sohn Lester, so wie dieser 22 Jahre alt, als die Geschichte beginnt, und öfter zu Gast in der Familie. T. verrät all die Details, die Miriam nicht wissen kann oder darf. Etwa wenn er Spekulationen um einen vermuteten Marihuanakonsum der Jungs kommentiert. Oder wenn er uns Personen und Geschehnisse erklärt, die in Miriams Szenen angesprochen werden.
Handlung
Eine Handlung im klassischen Sinn gibt es nicht. Doch die zeitliche Einordnung der szenischen Episoden Miriams macht die Entwicklung all der Figuren aus Kitchawank deutlich. Was sie aus sich machen, was ihnen zustößt. Wie sie altern. Wie sich ihre Umgebung verändert, die Kolonie, in der sie ihr Leben verbracht haben.
Den See könnte man als Symbol des Vergänglichen sehen. Alle zwei Jahre wird der künstliche Strand mit frischem Sand aufgeschüttet. Die Menschen versuchen, ihre heile Welt zu bewahren. Der Sand, der ständig erneuert werden muss, könnte für Erinnerungen stehen, die ebenfalls nachgeschüttet werden, damit die Bilder der Vergangenheit aufrecht erhalten werden können.
Doch letztlich kann Vergängliches nicht für immer bewahrt werden. Ihr Mann Sid war Miriam ein Leben lang eine felsenfeste Stütze. Ein Baum von einem Kerl, der aber zuletzt, als er einem der bösen Kerle der Geschichte nachsetzt, im Streit zu Boden geht und wenige Tage später mit achtundsechzig Jahren an einem Schlaganfall stirbt.
Autobiografisches
„Wie ich sehe, habe ich mich noch in die Szene hineingeschrieben, ein Flüchtling aus meiner eigenen zerbrochenen Familie, der im Augenblick Ruhe gefunden hat.“
(Seite 291)
Mit diesem humorigen Textabsatz beginnt einer der Einschübe von T. Das ist meines Wissens die einzige Gelegenheit, in der T. C. Boyle sein eigenes Ich unverblümt in einer seiner Erzählungen verschriftlicht hat. Dieser T. ist kein anderer als der Autor selbst. Inwieweit aber Miriams Familiengeschichte authentisch ist, bleibt sein Geheimnis.
★★★★★
17. — Was uns von den Tieren unterscheidet
EN What Separates Us From the Animals
blockquote>“Sauberkeit, der Wunsch nach Ordnung, wo keine ist, das Bemühen, den Verfall um uns herum zu bekämpfen, das ist es, was uns von den Tieren unterscheidet, meiner Meinung nach jedenfalls.“
(Margaret, Seite 328)
Ort der Handlung: Irgendeine kleine Insel ein paar Kilometer entfernt vom US-amerikanischen Festland. Vermutlich an der Ostküste. Nur ein paar hundert Bewohner, plus Touristen in den Sommermonaten.
Personal: Margaret McKenzie vs. Dr. Austin Murdbritter, beide Mitte vierzig. Sie ist das personifizierte gesellschaftliche Gewissen der Insulaner. Margaret ist stets korrekt, gewissenhaft und steht für alle Regeln des guten Benehmens, der Etikette und des angemessenen Verhaltens in Alltag und Beruf. Gäbe es in den USA so ein Werk wie Über den Umgang mit Menschen von Adolph Knigge, dann wäre ohne Zweifel Margaret die Verfasserin.
Auf Mrs. Perfect prallt Austin, der neue Inselarzt. Er entpuppt sich von Anfang an als gesellschaftlicher Muffel, für den Feinheiten in der zwischenmenschlichen Beziehung nicht existieren. Außerdem – das müssen Margaret und die anderen Insulanerinnen entsetzt zur Kenntnis nehmen – ist der Mann ein Messi, der die von der Gemeinde gestellte Wohnung samt Praxis verkommen lässt. Doch leider, so muss man fast sagen, war er der einzige Kandidat für die Arztstelle. Und seinen Beruf scheint Austin zu verstehen.
Die zwanzigseitige Geschichte besteht aus einem Monolog Margarets, der tiefe Einblicke in die Psyche der Frau zulässt und in einem überraschenden Showdown endet.
★★★
18. — Good Home
EN Good Home
Im Kern ist die Titelgeschichte des Erzählbandes eine Familiengeschichte. Eine Familiengeschichte um den zehnjährigen Joey, dessen Onkel einem finanziell einträglichen, wenn auch gesellschaftlich geächteten Hobby nachgeht: Royce züchtet American Pit Bull Terrier und richtet sie zu Kampfhunden ab.
Joey
Joey ist ein russisches Waisenkind, das einst von Royces Schwester Shana und ihrem Mann adoptiert wurde. Als sich der Ehemann davonmachte, bot Royce seiner Schwester an, seinen Neffen Joey die Wochenenden auf einer weitläufigen Farm im Hinterland von Los Angeles verbringen zu lassen. Die Farm gehört Royces Kumpel Steve, die beiden Männer teilen sich die Kreditraten. Hier haben wir also schon ein bisschen von dem „Good Home“, das Joey trotz seiner traurigen Vergangenheit genießen kann. Oder besser gesagt: genießen könnte.
Denn tatsächlich bindet sein Onkel den kleinen Jungen in das Kampfhundetrainig ein, bei dem regelmäßig „Ködertiere“ ihr Leben lassen. Die Pit Bulls hetzen Hasen, Katzen, andere Hunde, die Royce natürlich irgendwo besorgen muss. Dabei spielt der strohblonde, unschuldige Joey eine wichtige Rolle. Denn Onkel und Neffe fahren stets gemeinsam zu Menschen, die inseriert haben, sie hätten Haustiere abzugeben. Dort spielt Joey den Besitzerinnen und Besitzern der geliebten Haustiere vor, dass die süßen Tierchen bei ihm ein gutes Zuhause finden werden. Denn dass all die Ködertiere nach wenigen Tage ein schreckliches Ende finden würden, verraten Royce und Joey natürlich nicht.
Gutes Zuhause?
Sehen wir einmal davon ab, dass die bedauernswerten Haustierchen auf der Farm natürlich genau das Gegenteil eines „Good Home“ erwartet. Wie sieht das denn mit Joey aus? Welche psychischen und seelischen Deformationen wird der Junge davontragen, wenn er jahrelang seine Wochenenden mit dem Onkel und dessen Kampfhunden verbringt? Auf den einundzwanzig Buchseiten der Kurzgeschichte macht T. C. Boyle deutlich, zu welchen Abartigkeiten der Mensch im Umgang mit anderen Geschöpfen des Planeten fähig ist.
★★★★
19. — In der Zone
EN In the Zone
Hintergrundwissen: „Die Zone“ dieser Kurzgeschichte ist ein Gebiet im Norden der Ukraine, etwa dreißig Kilometern rund um die Reste des Kernkraftwerks Tschernobyl. Im April 1986 war nach Bedienfehlern einer der Atomreaktoren geschmolzen. Damals war die Ukraine noch eine der sowjetischen Unionsrepubliken. In der Folge der Nuklearkatastrophe wurde eine Viertelmillion Einwohner der Zone umgesiedelt.
Doch wenige Hundert vor allem ältere Menschen, meist Frauen, kehrten bereits kurz nach der Katastrophe 1986 heimlich oder geduldet in ihre Dörfer zurück. Seither leben sie dort autark mit eigenen Gärten, Brunnen, Holzöfen, meist ohne Strom, und mit radioaktiver Belastung ihrer Nahrung. Solche Selbstsiedler nehmen über kontaminierte Pilze, Beeren, Wild, Milch sowie über Wasser radioaktive Isotope wie Cäsium-137, Strontium-90 und Plutonium-239 auf. Die in der EU geltenden Grenzwerte werden manchmal um das Fünfzigfache überschritten. Dennoch halten sich manche Rückkehrer dort seit Jahrzehnten ohne erkennbare akute Erkrankung auf.
Mascha und Leonid
In seiner Adaption des Lebens nach einem atomaren Super-GAU lässt T. C. Boyle Leonid Kowalenko und seine ehemalige Nachbarin Mascha Sischylajewa, beide in ihren Sechzigern, in ihr altes Dorf mitten im Wald der Sperrzone zurückkehren. Die beiden lieben ihr unabhängiges Leben in der wilden Natur, in die längst wieder Bären, Wölfe und Elche zurückgekehrt sind. Sie ignorieren Warnungen von Maschas Sohn Nikolai, einem Universitätsprofessor. Und eines Tages erleben die beiden sogar die Rückkehr einer jungen Familie in das ansonsten verlassene Dorf.
Diese nur achtzehnseitige Geschichte habe ich auch in der Liste von Boyles Erzählungen mit biografischem Charakter verlinkt.
★★★
20. — Los Gigantes
EN Los Gigantes
Der Sammelband klingt mit einer der kürzeren Geschichten aus, die schon nach sechzehn Seiten ihr Ende findet. Zweifellos hat mich die Erzählung sofort an das deutsch-nationalsozialistische Projekt „Lebensborn“ erinnert, bei dem es ab 1935 um „die Rettung der nordischen Rasse“ und die „qualitative Verbesserung des Nachwuchses unter Zuchtkriterien“ ging. Denn los gigantes | die Riesen dieser Geschichte sind eine Auswahl außergewöhnlich großgewachsener und kräftiger Männer, die sich in einem unbestimmten mittelamerikanischen Staat dazu verpflichten, in einem Lager zu leben mit keiner anderen Aufgabe, als Tag für Tag Geschlechtsverkehr mit groß gewachsenen Frauen zu haben. Das Ziel besteht darin, dem verehrten Präsidenten der Nation eine Armee gewaltiger Krieger zu schenken.
„Helme so groß wie Vogelbäder, Pullover wie Zelte.“
(Seite 376)
Der Ich-Erzähler der Geschichte ist einer dieser Riesen. Doch als er erfährt, dass es auch Zuchtlager für besonders klein gewachsene Bürger gibt – die Nation brauche doch schließlich auch Spione! –, geht ihm seine zarte Braut zu Hause im Dorf nicht mehr aus dem Kopf. Er muss da einfach raus!
★★★
~
Wer diese Besprechungen gern gelesen hat, interessiert sich eventuell auch für das Autorenprofil, das ich zu T. C. Boyle angelegt habe und in dem auch alle anderen Rezensionen zu Boyle-Romanen und -Erzählungen auf dieser Website zu finden sind.
Fazit:
Good Home ist ein kritisches, mitunter durchaus verstörendes, aber immer fesselndes Porträt einer Gesellschaft zwischen Fortschritt und Zerfall. Ein literarisches Spiegelkabinett, das die Leserschaft herausfordert. Die Texte bieten schonungslose, oft ironische Blicke auf die menschliche Natur und die Absurditäten des modernen Lebens. Wie immer kombiniert Boyle seine präzise Beobachtungsgabe mit stilistischer Eleganz und einem ebenso unbeirrbaren wie unverwechselbaren Gespür für das Groteske. Es geht um Umweltzerstörung, um soziale Ungleichheit, zwischenmenschliche Konflikte und moralische Dilemmata – immer gerne durchzogen von Boyles düsterer Komik. Eigentlich ist das alles nichts Neues, aber es bedeutet: Wer die anderen Bücher diese Autors gerne gelesen hat, wird ganz sicher auch von Good Home angetan sein.
So gut wie immer bei Sammelbänden kommt meine Gesamtbewertung trotz meines Lesevergnügens nicht über den Durchschnitt von drei Bewertungssternen hinaus. Für vier von fünf möglichen hat es nicht ganz gereicht, auch wenn mein Algorithmus am Aufrundungswert von 3,5 Sternen kratzt.
T. C. Boyle, Good Home
DE Carl Hanser Verlag, 2018
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)