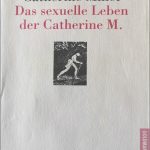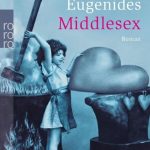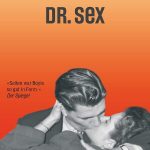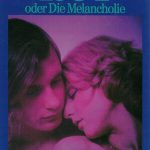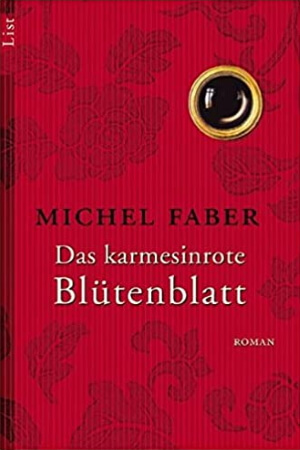
Als Michael Fabers Roman im Jahr 2002 erschien, urteilte das Time Magazine überschwänglich: „Dieses Buch zu lesen ist besser als Sex!“ Derlei Werbung macht natürlich Appetit auf die Geschichte. Doch nach der Lektüre muss ich leider anmerken, dass der Vergleich aus der Time-Rezension jeder Grundlage entbehrt. Trotzdem, das will ich gleich hinterherschieben, ist der Roman ein absoluter Leckerbissen für Leseratten.
Die Romanhandlung trägt sich im viktorianischen London zwischen November 1874 und Februar 1876 zu. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung gehören der sozialen Unterschicht an. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts verschlimmerten sich die ungesunden und unhygienischen Lebensverhältnisse in den britischen Städten. Die obere Mittelschicht hingegen strebte einen Lebenswandel nach aristokratischem Vorbild an.
Zur Handlung
Der rote Faden der Geschichte ist schnell erzählt: William Rackham, müßiggehender Erbe eines Parfümherstellers und Ehemann einer überspannten Dame aus adeliger Familie, trifft auf die neunzehnjährige Prostituierte Sugar. Das Mädchen zieht den älteren Mann in ihren Bann. Er nimmt sogar das verhasste Familiengeschäft auf, nur um stets flüssig zu sein. Ausreichend vorhandenes Geld soll es ihm ermöglichen, sich Sugar als persönliche Kurtisane zu halten. Das Strichmädchen sieht seine Chance gekommen.
Sie schmeichelt sich ein, macht sich unentbehrlich und zieht schließlich als Gouvernante der kleinen Tochter der Rackhams in deren Haushalt. Der vermeintliche soziale Aufstieg entpuppt sich jedoch rasch als Enttäuschung. Die Geschichte gipfelt schließlich in einer Kurzschlusshandlung Sugars, die ich zwecks Erhalt der Lesespannung lieber für mich behalte.
Der Autor gliedert die 1.053 Romanseiten in fünf Teile, die dem eben angerissenen Ablauf entsprechen: Die Straße, Das anrüchige Haus, Die Privatwohnung und das Gesellschaftsleben, Der Schoß der Familie und letztlich Die weite Welt. Oberflächlich betrachtet beschränkt er sich bei seinen Erzählungen auch auf den offensichtlichen Ablauf der Geschichte. Dieser für sich allein genommen wäre allerdings ein mäßiges Vergnügen. Sonderlich einfallsreich oder überraschend ist die Rahmenhandlung keineswegs.
Pornographie? – „Besser als Sex“?
Diese Erkenntnis könnte den Schluss nahe legen, Faber habe lediglich ein Transportmittel für pornografische Schilderungen gesucht. Dies trifft jedoch nicht zu. Zwar geizt der Autor nicht mit teilweise detaillierten Beschreibungen der Begegnungen zwischen Prostituierten und deren Freier. Aber wie auch in Das sexuelle Leben der Catherine M. fehlt den Schilderungen das erregende Moment.
Selbst wenn Sperma in die verschiedensten weiblichen Körperöffnungen spritzt, betrachtet Michael Faber die Geschehnisse aus unbeteiligter Perspektive. Er verwendet unspektakuläres Vokabular und stellt die Szenen in Zweckzusammenhänge, so dass erotische Lust beim Lesen kaum aufkommen mag. Insofern ist der erwähnte Vergleich mit Sex durch das Time Magazine schlichtweg nicht zutreffend.
Wirkliche Lese-Lust entsteht vielmehr durch die Geschichten hinter der Geschichte. Autor Faber räumt zwar im Abspann ein, „dass diese Erzählung zweifellos voller Irrtümer steckt“. Dennoch ist es ihm gelungen, ein farbenprächtiges, mit Originalgerüchen ausgestattetes, dreidimensionales Gemälde des Lebens im viktorianischen London zu erschaffen.
Man lebt quasi Seite an Seite mit den Hauptpersonen des Romans, der nicht etwa nur aus Sicht Sugars geschrieben ist. Alle auftretenden Figuren – insbesonders aber William, dessen Frau Agnes, die Tochter Sophie, der Bruder Henry und dessen erzwungen-platonische Liebe Emmeline Fox – teilen ihre Gedanken, Ängste und Vorlieben mit dem Leser. Wir tauchen ein in eine längst vergessene Welt, in deren Gefahren und Reize, in deren Moralvorstellungen und Gebräuche. Aus den verschiedenen Sichtweisen des wohlhabenden Bürgertums, ihrer Dienstboten, der Straßenhändler und Dirnen Londons setzt sich ein komplexes Puzzle zusammen. Stück für Stück wird das Londoner Leben erkennbar, so wie es sich gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts zugetragen haben mag.
Gesellschaftlicher Voyeurismus
Michael Faber bedient sich eines Kunstgriffes, um seine Leserschaft in den Bann der Schilderungen zu ziehen, der mir persönlich sehr gefällt. Wie auch Jeffrey Eugenides in Middlesex zieht Faber den Leser ganz nah an seine Seite, indem er ihn direkt anspricht und einbezieht. Er weist uns den Weg durch das Buch wie der kundigste aller Londoner Stadtführer, verrät kleine Geheimnisse, um die keine der Romanfiguren weiß. Der Autor macht uns zu Komplizen, die seine Protagonisten mit voyeuristischem Vergnügen begleiten.
Nach all meinen Lobgesängen auf die intellektuelle Keuschheit des Romans muss ich nun aber trotzdem darauf eingehen, dass das Hauptthema die Prostitution im neunzehnten Jahrhundert behandelt. Die Protagonistin Sugar ist schließlich eine neunzehnjährige Dirne, der im Alter von dreizehn von der eigenen Mutter die ersten Freier zugeführt wurden. Neben Sugar tritt eine Vielzahl weiterer Prostituierter in Erscheinung. Einige dieser Berufskolleginnen spielen durchaus tragende Nebenrollen, der Großteil aber bleibt anonym. Dank all dieser Auftritte bekommt der Leser ein anschauvliches Bild der Lebensumstände von „gefallenen Frauen“ im viktorianischen England.
Insbesonders durch die gedanklichen Ausflüge Sugars in ihre Vergangenheit als Kinderhure kann man sich ausmalen, welche seelischen und körperlichen Grausamkeiten Prostituierte erdulden mussten. Von den psychischen Folgen kann man sich zumindest annähernd ein Bild machen, wenn Sugar Fragmente aus ihrem selbst geschriebenen, geheimen Roman zum Besten gibt. In ihrer Fantasie ist sie stets damit beschäftigt, ihre Freier zu misshandeln und gar abzuschlachten.
Kritikpunkt
An dieser Stelle muss ich allerdings auch geringfügig negative Kritik an Fabers Buch einfließen lassen. Dieser niemals abgeschlossene, geschweige denn veröffentlichte Roman Sugars wirkt zumindest auf mich aufgesetzt und will sich nicht so recht einfügen in die ansonsten so perfekt gestaffelten Romanszenen. Tatsächlich stören – nicht etwa verstören! – mich diese Sequenzen. Selbst wenn der unvollendete Roman im Roman zuletzt noch eine ziemlich wichtige Rolle im Handlungsverlauf erhält, bin ich der Ansicht, der Autor hätte die Bedeutung der Prostituiertenliteratur deutlicher akzentuieren sollen. Dass er dazu in der Lage gewesen wäre, beweisen andere Bücher im Buch, nämlich die Tagebücher Agnes Rackhams. Diese Schriften dokumentieren auf bestürzende Weise die Umstände und Konsequenzen, die letztlich zum Verfall der Ehefrau von William führten.
~
Der Roman wurde im Jahr 2011 als britische Fernsehserie in vier Episoden verfilmt. Gedreht wurde in Kent und Liverpool. In der Rolle Sugars ist die Schauspielerin Romola Garai zu sehen, Regie führte Marc Munden. Die Verfilmung wurde vornehmlich negativ aufgenommen, im Vergleich zum Roman sei die Inszenierung „chaotisch und unkonzentriert“, weise eine „gewisse Schlaffheit“ und „einen Mangel an Charakterentwicklung“ auf (Zitate von John Preston, The Daily Telegraph).
Fazit:
Wer ein Buch lesen möchte, das „besser als Sex“ ist, kann Das karmesinrote Blütenblatt getrost zur Seite legen. Der Roman ist keine erotische Literatur. Wer jedoch daran interessiert ist, in das pralle Leben der britischen Hauptstadt vor 130 Jahren einzutauchen, ist mit diesem Roman bestens bedient. Michael Faber erzählt einfach meisterlich, spart nichts aus und erspart dem Leser auch die unerfreulicheren Facetten der historischen Gesellschaft nicht.
Wären da nicht ein paar Schwächen im Ausbau einiger weniger Personen und Zusammenhänge, ich hätte nicht gezögert, dem Roman die Höchstpunktzahl zuzusprechen. Vier von möglichen fünf Sternen aber ist mir Das karmesinrote Blütenblatt auf jeden Fall wert.
Michael Faber: Das karmesinrote Blütenblatt
List Verlag, 2002