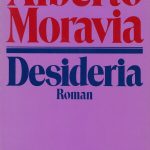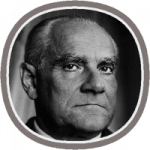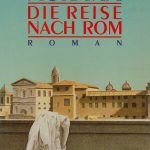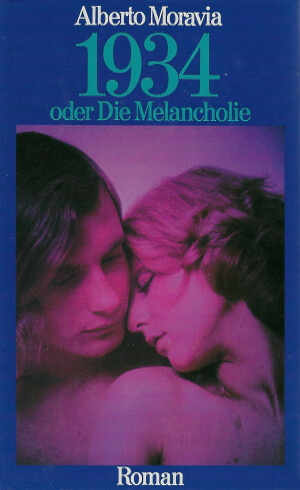
Nur vier Jahre nach seinem dicken Brocken Desideria veröffentlichte Alberto Moravia eine sehr persönliche Geschichte unter dem Titel 1934 oder Die Melancholie. Seine vorhergehenden Romane handelten in den Jahren der sexuellen Revolution oder danach. Bereits der Titel dieses Textes macht jedoch deutlich, dass der Autor diesmal weiter zurück in die Vergangenheit geht. Nämlich in die Jahre der Hoch-Zeiten des europäischen Faschismus in Spanien, Italien und Deutschland. Franco, Mussolini und Hitler haben ihre Macht gefestigt und kooperieren bereits. Um der Verzweiflung dieser Zeit zu entfliehen, begibt sich der junge italienische Schriftsteller Lucio nach Capri. Bei diesem Aufenthalt macht er die Bekanntschaft der deutschen Theaterschauspielerin Beate Müller, die mit ihrem Mann Alois, einem NSDAP-Funktionär, dort Urlaub macht. Eine höchst bizarre Beziehung nimmt ihren Lauf.
Bereits auf der Fähre von Neapel nach Capri werfen sich Lucio und Beate – ohne zuvor überhaupt Bekanntschaft zu schließen – aus der Ferne sehnsüchtige Blicke zu. Im bloßen Blickkontakt mit der jungen Frau glaubt der junge Römer, eine Leidensgenossin ausgemacht zu haben. Sie scheint ebenso verzweifelt zu sein wie er selbst. Also mietet er sich in der gleichen Pension im Inselort Anacapri ein wie das deutsche Ehepaar. Lucio hofft, dadurch eine Möglichkeit zur näheren Kontaktaufnahme mit dem unbekannten Objekt seiner platonischen Begierde machen zu können.
Der Roman ist inzwischen vierzig Jahre alt, die Handlung spielt vor beinahe neunzig Jahren. Doch angesichts des unübersehbaren Abdriftens europäischer Politik an den rechten Rand und nach den Ergebnissen der Parlamentswahlen in Italien am vergangenen Wochenende Ende September 2022, gewinnt die alte Geschichte unerfreuliche Aktualität.
Was geschieht auf Capri?
Die tatsächlichen Geschehnisse sind rasch erzählt. Der 27-jährige Lucio ist dank einer Apanage seines begüterten Vaters finanziell unabhängig. Nach einem Germanistikstudium in München verdient er sich mit Übersetzungen aus dem Deutschen etwas dazu. Im Juni ’34 will er auf Capri seiner Übertragung des Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist ins Italienische den letzten Schliff geben und danach einen eigenen Roman beginnen, in dem er seine abgrundtiefe Verzweiflung thematisieren möchte.
„Kann man in Verzweiflung leben, ohne sich den eigenen Tod zu wünschen?“
(Erster Romansatz, Seite 5)
Nachdem er allerdings der neunzehnjährigen Beate tief in die Augen geblickt hat, kommt er nicht mehr dazu, seine literarischen Absichten umzusetzen. Er verfolgt das deutsche Ehepaar beinahe auf Schritt und Tritt, stets auf der Lauer, ein paar Worte mit Beate wechseln zu können oder ihr wenigstens eine Nachricht zustecken zu können. Doch die Kommunikation zwischen den beiden jungen Leuten konzentriert sich auf den Augenkontakt. Allerdings auf einen sehr beredten, stets leidenden Augenkontakt, durch den sich Lucio „auf den ersten Blick“ in Beate verliebt, seine so offensichtliche Gefährtin in der Tiefe der gemeinsamen Verzweiflung.
Die Reaktion des Ehemanns Alois Müller, der die schweigende Kommunikation zwischen dem Italiener und seiner Frau sehr wohl wahrnimmt, ist merkwürdig. Er reagiert oberflächlich verärgert, duldet aber dennoch unausgesprochen die sich anbahnende Beziehung. In manchen Situationen ermutigt er Lucio gar, sich seiner Ehefrau zu nähern.
Schließlich spielt Beate ihrem italienischen Galan einen Gedichtband Kleists zu, in dem sie Textpassagen zu dessen Doppelselbstmord mit seiner Geliebten, Henriette Vogel, markiert hat. Sie fragt Lucio, ob auch er zu einem solchen Schritt – gemeinsam mit ihr – bereit wäre. Lucio sagt in einer ungezügelten Liebesanstrengung zu, obwohl er Beate lieber zu einer gemeinsamen Zukunft überredet hätte.
Beate wird zu Trude
Doch zum verabredeten Suizidtermin erscheint Beate nicht. Statt dessen reist das Ehepaar Müller am nächsten Tag ab. Wenig später trifft Lucio in der Pension auf ein Abziehbild seiner Beate. Es stellt sich heraus, dass Trude, die Zwillingsschwester Beates, und der beiden Mutter Paula das Zimmer des Ehepaars Müller übernommen haben.
Diese Trude erweist sich als extrovertiertes Gegenteil ihrer Zwillingsschwester. Sie erklärt Lucio, mit Beate über ihn gesprochen zu haben, und macht nicht den geringsten Hehl daraus, den jungen Mann zu ihrem Liebhaber machen zu wollen. Im Laufe des Techtelmechtels erweist sich jedoch, dass Trude keine andere als Beate selbst ist. Doch ob nun Beate oder Trude: Lucio kann keiner der beiden Instanzen der selben Frau widerstehen. Sein Verlangen nach der Frau wird erst ausgebremst, als sich herausstellt, dass die vermeintliche Mutter Paula in Wahrheit die Geliebte und langjährige Lebenspartnerin Trude-Beates ist. Nach der Radioübertragung einer Hitlerrede im Anschluss an die Säuberungswelle innerhalb der NSDAP, die unter der Bezeichnung Nacht der langen Messer historisch bekannt wurde und der auch die Romanfigur Alois Müller zum Opfer fiel, vollziehen Paula und Trude-Beate den „Doppelselbstmord à la Kleist“. Sie scheiden gemeinsam aus dem Leben.
Doppelgesichtig bis zum Schluss hatte sie [Beate] ohne den Mann, vor dem ihr graute, weil an seinen Händen Blut klebte, nicht weiterleben wollen. Und Paula wollte nicht weiterleben ohne Beate.
(Schlusssatz, Seite 288)
Doppelgesichtig?
Man könnte es auch drastischer ausdrücken. Diese Frau leidet an einer schweren Form einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung, sie ist eine weibliche Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Im zweiten Romanteil kippt sie in einem fort von Beate, der „Seeligen“, zu Trude, der „Starken mit dem Speer“, und wieder zurück. Schwierig wird es für die Leserschaft vor allem, weil keine der beiden Wesenspole der Protagonistin in irgendeiner Art und Weise Nägel mit Köpfen zu machen bereit ist. Die erste Hälfte der beinahe 400 Romanseiten schwadroniert diese Beate über die Erlösung eines Doppelselbstmordes. Sie weicht aber gleichzeitig einer Begegnung mit Lucio unter vier Augen aus, nur um zuletzt sang- und klanglos zu verschwinden. In der zweiten Romanhälfte provoziert dann Trude ihren Lucio ständig mit Ankündigungen des Geschlechtsverkehrs, ohne jedoch je den letzten Schritt zu machen.
Haben wir es mit einer Geschichte der Möchtegerns, Aufschneider und Verbalerotiker zu tun? Denn auch Lucio bleibt die ganze Zeit über merkwürdig passiv, macht alles mit und schwankt in seinen Moment-Ansichten ebenfalls ständig vom einen zum anderen.
Die russische Revolutionärin
Auch ein fast dreißigseitiges Zwischenspiel nach Beate und vor Trude verstärkt den bizarren Eindruck, den die Geschichte macht. Darin trifft Lucio die mehr als doppelt so alte Exilrussin Sonja. Er landet mit ihr im Bett, wo es allerdings auch wieder zu nichts kommt, abgesehen von einem ausführlichen Verhör der Marke Moravia (siehe zum Beispiel in Desideria). Dabei zieht Lucio dieser Sonja ihre Lebensgeschichte aus der Nase:
Als Studentin war die Frau in eine Gruppe russischer Revolutionäre geraten – ja, auch da haben wir wieder Desideria vor Augen. Sie wurde von einem der Männer geschwängert und stand schließlich vor der Wahl, ihren Liebhaber (der sich als Doppelagent erwiesen hatte) im Auftrag der Revolutionäre zu töten. Oder alternativ selbst getötet zu werden. Dieser Entscheidung wich Sonja damals aus, indem sie aus Sankt Petersburg verschwand. Sie floh ans Mittelmeer und strandete letztlich als willige Gelegenheitsbeischläferin für Kutscher und Seeleute auf Capri.
Was hat denn diese abgetakelte Russin in der Trude-Beate-Geschichte zu suchen? Dies wird sich die eine oder der andere Leser¦in durchaus mit einiger Berechtigung fragen.
Versuch einer Interpretation
Beginnen wir mit der Lebensgeschichte des Autors: Als Antifaschist erhielt er in den Dreißigerjahren Schreibverbot und verlor seine Arbeit als Journalist. Im Exil auf Capri begann er jedoch wieder zu schreiben. Es ist also mehr als nur wahrscheinlich, dass dieser Lucio, der auch noch genau das gleiche Alter hat wie Moravia, ein Alter Ego des Autors ist. Vermutlich war Alberto damals genauso verzweifelt wie sein Lucio – wegen seiner persönlichen, aber auch wegen der politischen Lage in Europa.
Ich litt unter einem Angstzustand: Weder für die nahe noch für die ferne Zukunft schien sich mir irgendeine Hoffnung zu bieten; ich spielte häufig mit dem Gedanken, als Lösung, als logischen, unvermeidlichen Ausweg aus dieser Hoffnungslosigkeit, den Selbstmord zu wählen, der mich von meiner Angst befreien würde.
(Seite 22)
Wer spricht da? Lucio oder Alberto? Sehr wahrscheinlich beide. Jedenfalls lässt der Autor sein Alter Ego all diese wunderlichen Begegnungen der Romanhandlung durchleben. Durch Lucios Blick sehen Alberto und seine Leserschaft dem Tanz der gespaltenen Persönlichkeiten zu. Wir versuchen zu begreifen, was sich da vor uns abspielt.
Die Macht des Faschismus
Trude-Beate und Paula sind lesbische Schauspielerinnen. In den Jahren zwischen den zwei Weltkriegen müssen die beiden zu den Unkonventionellen, Unangepassten gehört und mit der totalitären Unduldsamkeit des Faschismus Probleme gehabt haben. Wen wundert es, dass Trude-Beate dabei zerbricht und ihr sensibel-melancholischer Anteil in pure Verzweiflung umschlägt?
Ich verstehe die Persönlichkeitsspaltung so, dass die junge Frau irgendwann begriffen haben muss, sie würde den Nationalsozialismus nur heil überstehen, indem sie mit dem Teufel zu tanzen lernte. Indem sie einen Nazifunktionär heiratete, den sie zwar einerseits hasste. Aber der andererseits seine Schutzfunktion gegen Hitlers Schergen hervorragend erfüllte; und darüber hinaus den Vorteil hatte, der schwächere Partner der Beziehung zu sein. Und natürlich indem sie nach außen die überzeugte Nationalsozialistin spielte: die Trude mit dem Speer eben.
Als dann der Schutzschild Alois zerbrochen ist, bleibt Trude-Beate tatsächlich nur mehr die Flucht in den Suizid. Selbstverständlich aber nicht mit dem Beobachter Lucio sondern mit ihrer Herzdame Paula.
Mit der Verhaltensbeschreibung der zerrissenen jungen Frau gelingt dem Autor eine detaillierte Studie dessen, was die Grausamkeit des Faschismus aus sensiblen Menschen machen kann. Und mit seinem Lucio stellt er der deutschen Seele einen mediterranen Leidensgenossen entgegen. Der leidet vielleicht nicht weniger an seiner Verzweiflung, arrangiert sich jedoch mit ihr.
Ich glaube, das heißt, ich bin davon überzeugt und habe die absolute Gewißheit, daß die Verzweiflung der Normalzustand des Menschen sein sollte. Genauso natürlich wie die Luft, die wir atmen. […] Wir leben in einer verzweifelten Welt: Wir müssen uns daher ihren Gesetzen beugen.
(Seite 218)
Das Revolutionsintermezzo
Wie die ehemalige russische Revolutionärin in das Gesamtbild passt, ist wirklich schwer zu sagen. Tatsache ist, dass Moravia mit dieser Sonja wie schon gesagt ein Bild wiederaufnimmt, das er wenige Jahre zuvor mit seiner Desideria bereits skizziert hatte.
Beide, Desideria wie Sonja, sind als Frauen eher geduldete Randfiguren revolutionärer Zellen. Um dazuzugehören, lassen sie sich auf Geschlechtsverkehr mit Anführern der Revolution ein. Doch beide werden sie enttäuscht. Desideria erschießt den Mann, der für ihre Niederlage verantwortlich ist. Sonja hingegen vermeidet dies. Dafür zahlt sie den Preis, einsam alt zu werden und in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.
Ich könnte mir vorstellen, dass Moravia mit der Gegenüberstellung von Desideria und Sonja ein Plädoyer dafür anstimmt, dass ein Ende mit Schrecken dem Schrecken ohne Ende vorzuziehen ist. Damit zeigt er womöglich sein Einverständnis mit dem Doppelselbstmord der beiden deutschen Frauen.
~
Diese Buchbesprechung ist Teil meiner Retrospektive im Sommer 2022. Wem sie gefallen hat, wird vielleicht auch meine anderen Rezensionen zu Alberto Moravias Romanen lesen wollen.
Fazit:
1934 oder Die Melancholie gehört aus meiner Sicht zu den schwierigsten Romanen Alberto Moravias. Die Handlung allein ist grotesk und trägt albtraumhafte Züge. Ohne Kenntnis von Moravias eigener Vergangenheit und ohne andere seiner Romane zu kennen, ist der Zugang zu diesem Text schwierig.
Im Klappentext heißt es vollmundig: „Mit diesem fast gleichnishaften Roman zeigt der große Moralist Moravia am Beispiel der Figur Beate/Trude die beiden widersprüchlichen Komponenten des deutschen Wesens: romantisch und sensibel auf der einen, borniert und autoritär auf der anderen Seite.“ Diesem Urteil mag ich mich nur bedingt anschließen. Doch der aktuelle Wahlerfolg der rechtspopulistischen Partei Fratelli d’Italia mit ihrer Galionsfigur Giorgia Meloni beeinflusst meine Bewertung. 1934 oder Die Melancholie bekommt nach meinem Bewertungssystem deshalb gute drei von fünf möglichen Sternen.
Alberto Moravia: 1934 oder Die Melancholie
List Verlag, 1982