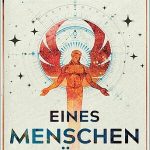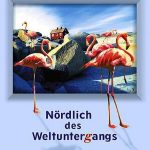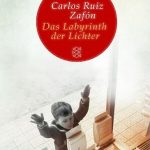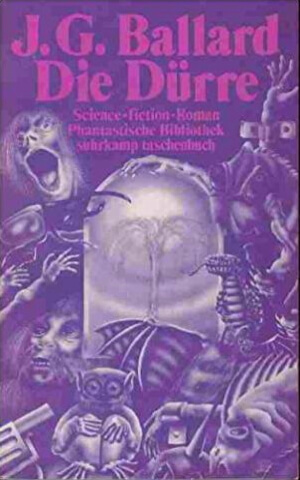
Im Jahr 1965, fast vierzig Jahre vor dem Erscheinen von Frank Schätzings aktuellem Bestseller Der Schwarm, schrieb der Engländer James Graham Ballard einen düsteren Ökothriller zum gleichen Thema: Die Dürre. Die rücksichtslose Schädigung der Umelt durch die Menschheit führt zu einer Naturkatastrophe, die Ozeane reagieren auf die Verschmutzung. In der Folge bleiben Regenfälle auf dem Festland aus, die Welt trocknet aus.
Um den Vergleich mit Der Schwarm abzuschließen, sei angemerkt, dass Ballards Roman sachlicher, aber in der Konsequenz auch weniger spannend bleibt, als Schätzings Epos. Die verseuchten Meere bringen keine gigantischen Ungeheuer hervor, die sich anschicken, Vergeltung an der Menschheit zu nehmen. Statt dessen erklärt Ballard das Ausbleiben von Regen mit einer wesentlich einleuchtenderen, weniger weit hergeholten These als später Schätzing.
Umweltkatastrophe à la 1965
„Ein fast zweitausend Kilometer breiter, dünner, aber unzerstörbarer monomolekularer Film aus gesättigten langkettigen Polymeren bedeckte die Küstengewässer der Weltmeere. Dieser Film wurde von den ungeheuren Massen an Industrieabfällen erzeugt, die während der letzten fünfzig Jahre in die Meere geleitet worden waren. Das zähe, sauerstoffdurchlässige Membran lag an der Schnittfläche von Wasser und Luft, weshalb das Verdampfen von Oberflächenwasser in den Luftraum fast völlig verhindert wurde.“
Kein Verdampfen des Meerwassers, kein Regen. Langsam aber sicher trocknen die Süßwasserreservoirs in Flüssen und Seen aus, die Landmassen des Planeten Erde verwandeln sich in Wüsten.
Über die Handlung
Der Autor erzählt in drei Teilen die Geschichte des Arztes Charles Ransom, der in Mount Royal am örtlichen Krankenhaus gearbeitet hatte. Die Stadt Mount Royal ist offenbar fiktiv, ihre Lagebeschreibung passt zu keiner der real existierenden Ortschaften gleichen Namens, die ich habe finden können.
Erster Teil
Die Geschichte setzt zu dem Zeitpunkt ein, als der große See bei Mount Royal wegen der anhaltenden Trockenheit bereits zu einer seichten Lache geschrumpft ist. Die meisten Einwohner der Stadt machen sich auf den Weg an die Küste. Davon versprechen sie sich, wenigstens in die Nähe von Wasser zu gelangen.
Ransom bleibt. Er beobachtet, wie in der Folge des Exodus alle geltenden Regeln menschlichen Zusammenlebens außer Kraft gesetzt werden. Doch als Mount Royal brennt, bricht auch er in einer Zweckgemeinschaft von fünf Personen auf in Richtung Meer. Kaum erreicht die Gruppe den Strand, bricht auch dort der Kampf ums Überleben aus.
Zweiter Teil
Nach dem Exodus überspringt Ballard zehn Jahre. Die Lebensumstände der Menschen nach anhaltender Dürre haben zu einer gnadenlosen Jagd nach Wasser und Nahrung geführt. Charles Ransom lebt zusammen mit einer Frau außerhalb der Stammessiedlungen, die sich gebildet haben. Sein Leben ist hart und triste. Als ein Löwe aus dem ehemaligen Zoo Mount Royals am Meeresstrand auftaucht, deutet Ransom dies als Zeichen für das Vorhandensein von Wasser im Landesinneren. Zusammen mit den übrig Gebliebenen seiner einstigen Reisegruppe macht er sich auf Weg zurück in seine Heimatstadt.
Dritter Teil
Der letzte Teil des Romans handelt von der Rückkehr nach Mount Royal. Ransom und seine Gefährten treffen dort auf frühere Bekannte, die auf wundersame Weise die Dürre in der Wüste überlebt haben. Doch leben diese in einer bizarren, nach Jahren aufgestauter Animositäten zugespitzten Situation. Die Konfrontation eskaliert letztlich. Durch einen unvermittelten Racheakt geht das kostbare Reservoir spärlichen Wassers verloren. Ransom flieht aus der absurden Szene und just in diesem Augenblick beginnt es endlich zu regnen.
Erfolgsrezept
Beeindruckend an Ballards Vision ist vor allen Dingen die Kraft der Details. Zwar düster und bedrückend, aber doch so folgerichtig ist seine Beschreibung des Niedergangs einer Stadt samt aller menschlicher Werte, jeglicher Rücksichtnahme. Ich bin überzeugt davon, dass sich Menschen im Ernstfall ziemlich genau so verhalten würden, wie es der Autor schildert:
Kultur und Verstand werden ersetzt durch animalischen Instinkt. Einstmals anerkannte religiöse Gemeinschaften entwickeln sich rückwärts. Sie werden wieder zu archaischen Gemeinden, denen Besucher mit persönlichen Anliegen Gastgeschenke (in Form von Wasser) darbringen müssen, um Gehör zu finden.
Einmalig personifiziert wird diese Entwicklung durch Quilter, einen zum Anfang der Geschichte als schwachsinnig abgestempelten Jungen. Nach dem Fall Mount Royals steigt Quilter gegen Ende des Plots von der sozialen Randexistenz zum Herrscher auf. Er versorgt den ehemaligen Geldadel der Stadt mit Nahrung; notfalls eben mit Menschenfleisch. Auf der anderen Seite profitiert er von seiner Ausnahmestellung. Er schwängert mehrfach die Schwester seines Ex-Arbeitgebers und setzt damit eine neue Generation deformierter Monster in die Welt.
Überraschende Detailgenauigkeit
Doch nicht nur die sozialen Veränderungen in der Welt der Dürre beschreibt der Autor in durchdachten Reflexionen. Auch Einzelheiten zu den Folgen in der Natur gibt er äußerst plastisch wieder. Der Leser bekommt das Gefühl, er laufe neben Charles Ransom durch austrocknende Landschaften und Wüsten.
Interessant, wenn auch in Hinblick auf die Entstehungszeit des Romans nicht überraschend ist die symbolische Qualität, die Ballard dem Automobil zugedacht hat. Schon während der Reise ans Meer spielen von ihren Besitzern verlassene Autos eine wichtige Rolle. Im weiteren Verlauf der Handlung stehen Autowracks einerseits für den Verfall industriellen Wohlstandes. Andererseits übernehmen sie aber auch die Rolle von Götzen.
Mein Bewertung
Leider fasst der Autor den zweiten Teil, die zehn Jahre der Dürre, äußerst knapp. Zwar beschreibt er, unter welchen Umständen die Romanfiguren leben. Aber ich hätte mir eine etwas umfassendere, weiter greifende Darstellung der Gedankengänge gewünscht, die Ballard in Bezug auf diese Rückversetzung in die Steinzeit vorschwebten. In meinen Augen hat er den Roman zu stark auf die Zeit des Exodus des ersten Teils konzentriert. Denn auch wenn Teil drei, die Rückkehr, zumindest detaillierter als der Mittelteil ausfällt, hätten auch hier noch einige Passagen inhaltlich tiefer ausformuliert werden können.
Darüber hätte es dem Roman sicher auch gut getan, wenn die Person des Charles Ransom mehr Gefühl mit auf ihren Weg bekommen hätte. Die Hauptfigur ist mir insgesamt zu steril, zu sehr Beobachter und zu wenig leidtragender Teilnehmer am Geschehen.
Das Ende der Geschichte bleibt weitgehend offen. Der einsetzende Regen gibt Grund zur Annahme, dass die Menschheit die Dürreperiode zwar stark dezimiert, aber zumindest insgesamt als Gattung überlebt. Welche Schlüsse aber die Überlebenden aus dem Vergeltungsschlag der Natur ziehen und wie sie ihr Leben organisieren werden, diese Überlegungen überlässt der Autor der Fantasie des Lesers.
Fazit:
Die Dürre ist eine erschreckend düstere Fiktion, die den Leser in eine ganz besonders aus heutiger Sicht durchaus vorstellbare Zukunft entführt. Die große Stärke des Buches liegt in der insgesamt schlüssigen Konstruktion eines Albtraumes, der auch viele Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung realen Schrecken verbreiten kann.
Wären da nicht die beschriebenen Einschränkungen im dritten, vor allen Dingen aber im zweiten Teil, hätte ich nicht gezögert, James Graham Ballard für seine Vison vier Sterne zu spendieren. Etwas mehr Umfang hätten aus der Erzählung einen wirklichen Roman machen können. So aber bleibt es eben bei drei von fünf möglichen Sternen.
James Graham Ballard: Die Dürre
Suhrkamp Verlag, 1984