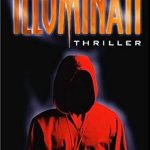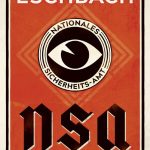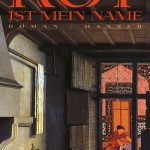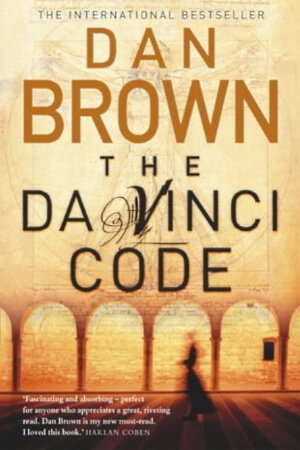
Im englischen Original lautet der Titel von Dan Browns Bestseller The Da Vinci Code. Damit nimmt der Autor Bezug auf ein zentrales Thema seines Thrillers. Der deutsche Romantitel hingegen nennt beim Namen, welche Reaktion Brown mit der Kernthese seiner Geschichte ausgelöst hat: Als „Sakrileg“ betrachten manche Christen die gewagte Unterstellung einer intimen Beziehung zwischen dem historischen Jesus Christus und Maria Magdalena. Den Verkaufszahlen des Buches kommt der Streit zwischen den Lagern zu Gute. In den vergangenen Wochen stand Sakrileg über Wochen hinweg an der Spitze der Bestsellerlisten in Deutschland.
Vier Jahre nach Angels And Demons, das in der deutschen Übersetzung unter dem Titel Illuminati erschien, veröffentlichte Dan Brown die Fortsetzung der Erlebnisse seines Helden Robert Langdon. Wie bereits in der Rezension zu Illuminati im Detail beschrieben wurde, wirkt der Vorgängerroman wie ein Entwurf für Sakrileg. Sehr wahrscheinlich stimmen mir viele Leser zu, die beide Bücher kennen: Die zweite Geschichte wirkt zumindest in Bezug auf Stimmigkeit und Überzeugungskraft des Plots ausgewogener und gelungener. Weniger Anleihen bei James Bond und Indiana Jones erhöhen Realitätsbezug und Wahrscheinlichkeit der Handlung im Vergleich zu Illuminati deutlich. Auch wenn der Autor seinen Protagonisten in den ersten Abschnitten des zweiten Romans augenzwinkernd als „Harrison Ford in Harris Tweed“ beschreibt.
Zur Handlung
Nach einem Vortrag, den Langdon in Paris hielt, wird er mitten in der Nacht von der französischen Kriminalpolizei aus dem Hotel in den Louvre gebracht. In einem der Ausstellungsräume liegt die unbekleidete Leiche des Museumskurators. Der Leichnam ist arrangiert wie auf Leonardo Da Vincis berühmter Proportionsstudie nach Vitruv. – Dem nackten „Schneeengel“, gerahmt von Kreis und Quadrat. Robert Langdon hatte eine Verabredung mit dem Toten gehabt, zu der dieser nicht erschienen war.
Die Polizei bittet den Symbolologen Langdon um Mithilfe beim Enträtseln des merkwürdigen Mordszenarios. Von diesem Moment an überschlagen sich die Ereignisse. Der Protagonist trifft noch im Museum die Enkelin des Opfers, Sophie Neveu. Diese gibt ihm zu verstehen, dass er nicht Helfer, sondern Tatverdächtiger sei. Sie überredet ihn zur Flucht und beginnt mit seiner Hilfe die erstaunlichen Rätsel zu dechiffrieren, die ihr Großvater im Angesicht des Todes hinterlassen hatte.
Religionsgeschichtliche Einordnung
Das klingt nicht nur in meiner extremen Kurzfassung merkwürdig. Bei genauerem Hinsehen ist die Geschichte auch im Original äußerst verwegen angelegt. Dies gilt nicht nur für die kriminalistische Rahmenhandlung. Auch die historische Aussage, die Dan Brown für seine Leser formuliert, ist gewagt.
Um es vorweg zu nehmen: Der Tote im Louvre war der oberste Tempelritter, Vorsteher der Priorie de Sion. Der Zweck dieses Geheimbundes besteht darin, Inhalt und Aussage des Heiligen Grals zu bewahren. Der Autor hat weitgehende Recherchen angestellt. Er webt in die spannende Handlung seines Thrillers eine höchst umstrittene These:
Der Heilige Gral sei im Wesentlichen kein monetärer Schatz. Er sei auch nicht die Schale, in der Jesu Blut aufgefangen wurde. Vielmehr handle es sich um ein abstraktes Geheimnis, das die katholische Kirche seit vielen Jahrhunderten zu verschleiern versuche. Jesus Christus sei mit Maria Magdalena verheiratet gewesen. Mit ihr habe er ein Tochter namens Sarah gezeugt. Mutter und Tochter seien nach dem Kreuztod Jesu verschwunden. Doch die Blutlinie des Christenkönigs und Maria Magdalenas habe in Frankreich weitergelebt. – Heiliges Blut, Sang Real, Sang Raal, Sangraal, der Heilige Gral …
Da schluckt der Leser erst ein- oder zweimal. Vor allen Dingen, wenn er am Ende des Romans die Pointe präsentiert bekommt: Dass nämlich ausgerechnet die Co-Protagonistin Sophie Neveu und deren Bruder die beiden letzten lebenden Nachkommen der Blutlinie Jesu Christi sein sollen.
„Schund!“, schreit er, der gebeutelte Leser, „billiger Quatsch, an den Haaren herbei gezerrt!“
Historische Bewertung
Aber so einfach sollte er es sich nicht machen, der Leser. Denn zwar hat sich Dan Brown wieder einmal die Rosinenstückchen aus allen möglichen Interpretationen der Religionshistorie herausgepickt. Diese hat er äußerst publikumswirksam zum Thema seines Romans verarbeitet.
[Nachtrag: Beide Brown-Romane wurden übrigens – wie nicht anders zu erwarten – verfilmt. Sakrileg erschien 2006 in den Kinos, Illuminati 2009. In beiden Filmen spielte Tom Hanks die Rolle des Robert Langdon.]
Die These, Jesus und Maria Magdalena seien liiert oder gar verheiratet gewesen, wird bereits seit mehreren Jahrzehnten von ernst zu nehmenden Historikern öffentlich vertreten. Diese berufen sich dabei auf Textstellen erst in der Neuzeit entdeckter, historischer Dokumente, etwa auf das Philippus-Evangelium. Dort ist die Rede davon, dass Jesus seine erste Jüngerin oft auf den Mund küsste. Dadurch habe er Eifersucht unter seinen männlichen Gefolgsleuten provozierte. Auch offensichtliche Kontroversen zwischen Petrus und Maria Magdalena werden gerne als Grundlage der Ehethese angeführt. In der Konsequenz, so heißt es, habe später die katholische Kirche, die sich als Nachkommenschaft Petri durch die Dominanz einer Frau existenziell bedroht gefühlt habe, Maria Magdalena verunglimpft und ihre wahre Rolle vertuscht.
Anhänger der vatikanischen Auslegung hingegen argumentieren damit, man dürfe den Austausch von Küssen zwischen Maria und Jesus keinesfalls wörtlich nehmen. Man müsse ihn vielmehr metaphorisch interpretieren. Vor allem aber sei die These einer Eheschließung oder gar einer Blutlinie des Erlösers, die bis in unsere Zeit hinein existiere, in keiner Weise zu belegen.
Meine Einordnung
Partei zu ergreifen für eine der grundsätzlich verschiedenen Auslegungen, wage ich schon alleine aus fachlicher Unkenntnis nicht. Jeder Leser des Romans von Dan Brown mag sich sein eigenes Urteil bilden.
Auf jeden Fall hat der Autor mit Sakrileg zweifelsohne den Verdienst erworben, die Diskussion um die möglichen Varianten der Erlösergeschichte aus dem Elfenbeinturm hinaus in die breite Öffentlichkeit getragen zu haben. Wer sich über die spannungsgeladene Handlung hinaus für Hintergründe interessiert, sollte sich einen kompetenten Kommentarband zu Gemüte führen. Ein solcher behandelt die Widersprüche viel detaillierter und kompetenter, als ich es an dieser Stelle kann. Empfehlenswert wäre sicher Die Wahrheit über den Da-Vinci-Code von Dan Burstein.
~
Übrigens: Wem das Sakrileg in seiner historischen Einordnung gefällt, den könnte vielleicht auch meine Buchbesprechung zu Illuminati interessieren.
Fazit:
Sakrileg wirkt im Vergleich zur Vorgeschichte, die auf deutsch unter dem Titel Illuminati veröffentlicht wurde, um ein Vielfaches überzeugender und interessanter. Der Roman ist bestens dazu geeignet, Fantasien zu entzünden, oder aber auch einfach nur das Lesevergnügen von Thrillerfans zu befriedigen.
Wenn da nicht die leider immer noch ziemlich plumpe Schreibe des Autors wäre, ich hätte mit Vergnügen die vollen fünf Sterne vergeben. So aber bringt es Dan Brown immerhin verdient auf vier Zähler.
Dan Brown:
The DaVinci Code | Sakrileg
🇺🇸 Bantam Press, 2003
🇩🇪 Lübbe Verlag, 2006
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)