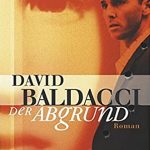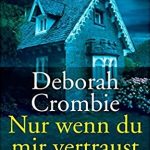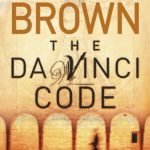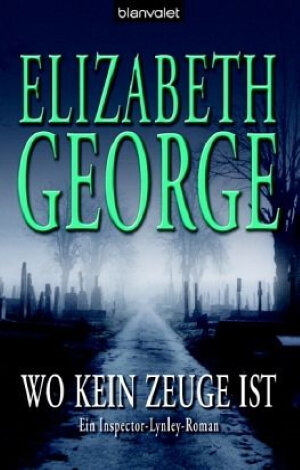
Jack The Ripper schlitzt im dritten Jahrtausend keine leichten Londoner Mädchen auf, sondern männliche Jugendliche. Eine Mordserie an Zwölfjährigen gibt den Rahmen ab für die dreizehnte und jüngste Folge der Kriminalromane um die Scotland-Yard-Ermittler Lynley und Havers. Der Roman Wo kein Zeuge ist der US-Amerikanerin Elizabeth George hat buchstäblich alles: Eine rätselhafte Mordserie, die eine Herausforderung an Intelligenz und Bauchgefühl der Ermittler darstellt. Zwischenmenschliches, das mit der Mördersuche zwar nichts zu tun hat, aber die Beamten zu Identifikationsfiguren werden lässt. Sozialen Sprengstoff durch die Integration von Reizthemen wie Rassenproblematik und Pädophilie. Persönliche Stellungnahmen zu aktuellen Streitpunkten wie „eingebettetem“ Journalismus oder Integrationsprojekten für sozial gefährdete Jugendliche. – Ein Potpourri an Charakteren, Szenen und Randberichten, das die Einschränkung auf das Genre „Krimi“ fast nicht mehr gelten lässt!
Wer tritt auf? – Personalien
Auf beachtlichen achthundert Romanseiten erzählt die Autorin abwechselnd aus Sicht von fünf der handelnden Personen die Abfolge der Geschehnisse, die letztlich zur Aufklärung der Mordserie führt. Die beiden Protagonisten sind Kriminalkommissar Thomas Lynley, aristokratischer Supermann und Held der vorangegangenen Romane der Serie, und seine hoffnungslos unorganisierte, sture, aber kriminalistisch erfolgreiche Assistentin Barbara Havers, die ebenfalls aus früheren Folgen bekannt ist.
Dazu gesellt sich Winston Nkata, ehemals Straßenkrieger und nun Kriminalpolizist ohne Fehl und Tadel – ein neuer Mann im Serienpersonal? Weitere Rollen übernehmen Ulrike Ellis, Leiterin einer Jugendhilfeorganisation, und natürlich der Mörder selbst, der sich selbst Fu nennt und irgendwo im Dreieck zwischen Allmachtsfantasie, Minderwertigkeitskomplexen und Schizophrenie agiert.
Um die zentrale Personalausstattung herum gruppiert George ein Sammelsurium von Statisten, die dem Roman Farbe geben. Ein jugendlicher Transvestit, ein zwielichtiger Albino, ein ebenso machtbesessener wie unfähiger Manager des Scotland Yard. Ein genialer und schrullig auftretender Profiler. Reporter, die für ihre Story buchstäblich über Leichen gehen. Gut aussehende Ehemänner, die fremd gehen. Attraktive Witwen und von ihren Frauen verlassene Väter. All diese Figuren tappen durch das winterlich klamme, ungemütliche London und liefern mehr oder weniger wichtige Beiträge zum Fortgang der Handlung. Sie legen falsche Fährten oder beleuchten eines der Randthemen, die die Autorin in ihren Krimi eingewoben hat.
Bewertung
Langeweile kommt bei der Krimilektüre nicht auf, zumal Elizabeth George keine der Szenen und keines ihrer Themen überstrapaziert. Vielmehr führt sie ihre Leserschaft von einem Cliffhanger zum nächsten. Allerdings liegt gerade im Dahineilen von einem zum nächsten Thema die größte Schwäche der Geschichte. Weniger wäre bestimmt mehr gewesen.
Meine Eingangsbemerkung, der Roman habe buchstäblich alles, war durchaus kritisch gemeint. Elizabeth George lässt kein aktuelles Thema aus, buhlt geradezu um Gunst und Zustimmung der Leserschaft.
Natürlich hängen alle Jugendlichen am Rande der Einkaufszentren herum, den Tempeln der Konsumgesellschaft, provozieren dort die Älteren und schüchtern Passanten ein. Natürlich ist die Welt voll pädophiler Monster, die sich nachts in den Räumen von Kindergärten treffen, um sich dort aufzugeilen. Natürlich ist London eine dem Untergang geweihte Stadt, deren Mauerwerk durchgehend rußschwarz ist und deren Verkehrsadern chronisch verstopft sind, weil alle Welt – einschließlich der Polizei – ihre fahrbaren Untersätze rücksichtslos einsetzt und abstellt. Und natürlich ist der Albino ein Bösewicht, dem die Kommissarin schon nach wenigen Romanseiten auf die Schliche kommt. Wie könnte dies auch anders sein, schließlich war sein literarischer Vorläufer Silas in Dan Browns Illuminati ebenfalls ein Schurke.
Wenn wir gerade beim Vorwurf der inhaltlichen Anleihen sind, sei darauf hingewiesen, dass mich die Figur des mörderischen Fu in ihrer akribischen und soziopathischen Vorgehensweise stark an Hannibal Lecter aus den Romanen von Thomas Harris erinnerte.
Erfolgsrezept
Eines muss man der Autorin jedoch zugestehen. Trotz der allgegenwärtigen gesellschaftskritischen Einschübe, die das Buch auf die erwähnten, immensen achthundert Seiten anschwellen lassen, gelingt es ihr, einen Spannungsbogen zumindest aufzubauen. Allerdings erschlafft der Ballon der Spannung im Laufe der zweiten Romanhälfte. Die Auflösung des Falls ist schließlich enttäuschend.
Einmal abgesehen davon, dass die Identifikation des Mörders vollkommen willkürlich ist – jede andere der verdächtigen Personen hätte es auch im Nachhinein ebenso gut sein können -, verliert der Plot zuletzt jegliche Form. Beiläufig erfährt der Leser, wer für die Morde verantwortlich ist. Beiläufig wird noch ein Trittbrettfahrer entlarvt, dessen Identität natürlich ins Bild passt. Und schließlich versickert die Geschichte irgendwo im Nichts. Wobei George es nicht versäumt, wenigstens ein paar lose Enden für Fortsetzungen herumliegen zu lassen.
Es wird wohl das Geheimnis der Verfasserin bleiben, warum die Beamten von Scotland Yard noch ein paar hundert Seiten lang ermitteln müssen, nachdem sie bereits das Fahrzeug des Mörders identifiziert und dessen Vorbesitzer ausfindig gemacht haben. Selbst Amerikanern sollte bekannt sein, dass Automobile in Europa Nummernschilder tragen, die Rückschlüsse auf den Halter zulassen. Solche Schnitzer sind enttäuschend und peinlich.
Fazit:
Von der „Meisterin des englischen Kriminalromans“ hätte ich auf jeden Fall deutlich mehr erwartet. Die kriminalistische Handlung ist zwar nett eingefädelt, endet aber äußerst fade. Die vielen Nebengeschichten sind größtenteils banal. Und das Bild der Gesellschaft, das Elizabeth George patchworkartig skizziert, ist bestenfalls populistisch zu nennen. Die Geschichte ist beliebig und oft zusammenhangslos.
Georges Trittbrettfahren bei erfolgreichen Thrillern macht den Roman nicht attraktiver. Dass die Autorin handwerklich in der Lage wäre, es besser zu machen, ist am Aufbau zumindest der ersten Hälfte ansatzweise zu erkennen. Doch dies bringt dem Roman trotzdem nicht mehr als einen von fünf möglichen Bewertungssternen ein. Als leichte Abschwächung dieses Verrisses sei angemerkt, dass sich dieser literarische Parcour de Force trotz seiner mannigfaltigen Schwächen recht flüssig liest: BILD-Zeitungsniveau für Leseratten.
Ich bedanke mich herzlich bei der Buchhandlung Bollinger für das zur Verfügung gestellte Leseexemplar
Elizabeth George: Wo kein Zeuge ist
Blanvalet Verlag, 2006
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)