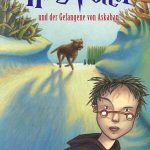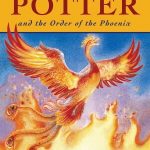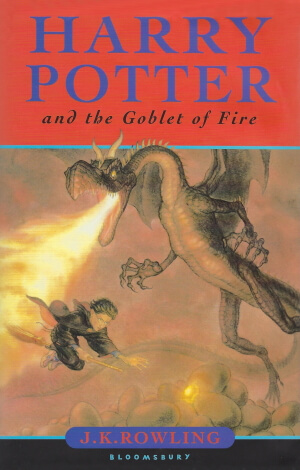
Ten years after: Auf den Tag genau vor zehn Jahren begann in Großbritannien der Verkauf des vierten Harry-Potter-Romans, Harry Potter und der Feuerkelch. Bereits am Erscheinungstag verkaufte sich der Roman über 370.000 Mal. Auch ich hatte mir an diesem heißen Sommersamstag kurz nach der Jahrtausendwende in aller Frühe die aktuellste Folge der rowlingschen Zauberergeschichte besorgt und fraß mich über das Wochenende hinweg durch die gut 630 Buchseiten. Denn auch mich und meine Kinder hatte der Hype um Harry Potter, seine Freunde und seine Feinde gepackt; auf die deutsche Übersetzung wollten wir nicht warten. Wie würde es weitergehen nach den verblüffenden Erkenntnissen über Harrys Familienhistorie im dritten Band?
Den ersten Band hatte die Autorin einer Einführung in die Welt der Zauberer gewidmet, einer Welt, über die wir gewöhnlichen, unmagischen „Muggel“ nur staunen konnten. Der zweite Teil vertiefte das Thema der Rassentheorie, also die Einteilung der Menschen in Zauberkundige und -unkundige. Und im dritten Band verriet uns Joanne Rowling so einige Geheimnisse über Herkunft und Geschichte der Potters und ihren Familienkampf gegen den bösen Lord Voldemort.
Worum geht es im vierten Roman?
Nun also ist die Leserschaft mit allem, was die Welt des Zauberlehrlings Harry Potter ausmacht, vertraut. Deshalb kann die Autorin das bekannte Ablaufmuster der drei ersten Bände getrost variieren und das Publikum auf das unausweichliche Grauen des Restes der Saga einstimmen. Folgerichtig setzt die Geschichte diesmal nicht wieder mit einem Sommer des Schreckens ein, den der Held im Ligusterweg bei seiner unmagischen Dursley-Verwandtschaft verbringen muss. Vielmehr machen wir im ersten Kapitel endlich persönlich Bekanntschaft mit dem, „dessen Name nicht genannt werden darf“. Der dunkle Lord Voldemort kehrt zurück in die magische Welt. Zu schwach noch, um sich erneut zu zeigen; aber doch als der Schreckensherrscher, der nicht gewillt ist, sich geschlagen zu geben, auch wenn er vierzehn Jahre zuvor so überraschend ausgeschaltet worden war.
Die Quidditch-WM
Davon ahnt Jungzauberer Harry allerdings noch wenig, auch wenn ihm Narbenschmerzen aufziehendes Übel ankündigen. Zunächst ist er nämlich viel zu sehr damit beschäftigt, sich mit seinen magischen Freunden, Hermine Granger und der Weasley-Familie, auf ein sportliches Großereignis zu freuen. Denn Hermine und die ganze Weasleybande haben Eintrittskarten für das Finale der Quidditch-Weltmeisterschaft und besuchen das 422. Endspiel zwischen Irland und Bulgarien. Diese Passage erinnert schwer an ganz reale britische Erfahrungen beim nicht-magischen Fußball. Denn in der Vorausscheidung sind die Engländer
„[…] gegen Transsilvanien untergegangen, dreihundertneunzig zu zehn“, sagte Charlie trübselig. „War grausam mit anzusehen. Und Wales hat gegen Uganda verloren, und Luxemburg hat Schottland abgeschlachtet.“
(Seite 69)
Soviel sei verraten: Das irische Quidditchteam besiegt die Ungarn trotz deren herausragenden Suchers. Doch die Siegesfeier in der folgenden Nacht mündet in eine Machtdemonstration der dunklen Seite der Magie.
Das Trimagische Turnier
Quidditch hin, Quidditch her; auch das anschließende Schuljahr an Hogwarts bietet eine außergewöhnliche sportliche Attraktion. Die Schule richtet eine Art olympischen Dreisprung aus, nämlich das internationale Trimagische Turnier.
Das Trimagische Turnier fand erstmals vor etwa siebenhundert Jahren statt, als freundschaftlicher Wettstreit zwischen den drei größten europäischen Zaubererschulen – Hogwarts, Beauxbatons und Durmstrang. Jede Schule wählte einen Champion aus, der sie vertrat, und diese drei mussten im Wettbewerb drei magische Aufgaben lösen.
(Seite 197)
Wir ahnen es alle längst: Für die Hogwartsschule werden aus zunächst nicht erklärlichen Gründen zwei Vertreter ausgelost, nämlich Cedric Diggory und Harry Potter, auch wenn dieser sich gar nicht beworben hatte. Wer hätte das gedacht.
Natürlich kommt es, wie es kommen muss. Harry laviert sich nicht nur durch sein viertes Schuljahr sondern auch mit viel Glück und Unterstützung durch das Turnier. Zum Schluss stehen Cedric und Harry Seit‘ an Seit‘ vor dem Triumph und …
(Aber das Ende verrate ich jetzt nicht. Wer es unbedingt wissen mag, der lese eben den hier verdeckten Spoiler.)
Spoiler aufklappen
Spoiler verbergen
Was jedoch als geteilter Triumph geplant war, erweist sich als tödliche Falle. Der Pokal ist verhext und transportiert die beiden Schüler auf einen fernen Friedhof. Dort wartet Lord Voldemort mit seinen Getreuen. Cedric wird sogleich ermordet. Und Harry soll anschließend zur Machtdemonstration des bösen Schwarzmagiers im ungleichen Duell hingerichtet werden. Doch der Todesfluch Voldemorts scheitert dabei ein zweites Mal. Denn die Zauberstäbe der beiden Kontrahenten verbinden sich und rufen die Geister der letzten Opfer Voldemorts auf den Plan.
Im folgenden Tumult gelingt es Harry, mit der Leiche des Schulfreundes im Schlepptau erneut den verhexten Pokal zu greifen und damit zurück nach Hogwarts zu gelangen. Zwar ist sein finsterer Gegenspieler wieder erstarkt. Doch Harry Potter kann erneut entkommen.
~
Spoiler verbergen
Zusammenfassung und Einordnung
Der vierte Potter-Roman ist ein Ausbruch aus dem Strukturgerüst der drei Vorläufer. Der bisher ewig gleiche Jahresablauf weicht einer wegweisenden, wenn auch schrecklichen Zukunftsaussicht. Gleichzeitig wird aus dem kleinen Harry unübersehbar ein Heranwachsender – mit allen Freuden und Problemen eines Jugendlichen an der Schwelle zur Pubertät. Und die überschaubare Welt der englischen Zauberei öffnet sich in internationale Weiten.
Beauxbaton und Durmstrang
Man muss der Autorin Respekt zollen für ihren gelungenen Ansatz der Internationalität. Schon die Namen der beiden Geschwisterschulen zaubern der Leserschaft ein Grinsen in die Gesichter. Die hochnäsigen „Schönstäbe“ aus dem französischen Beauxbaton treffen auf Osteuropäer mit slawischen Namen aus den eisigen Gefilden von Durmstrang, das man durchaus als Verballhornung des deutschen Begriffs „Sturm und Drang“ lesen kann.
In den späteren Romanfolgen werden wir schließlich auf die von Rowling skizzierten Parallelen zwischen rassistischen Schwarzmagiern und der Naziherrschaft stoßen, siehe etwa im Orden des Phönix.
Rückkehr des dunklen Lords
Das für die weitere Entwicklung der Geschichte wichtigste Handlungselement stellt natürlich die Rückkehr Voldemorts in seine schauerliche Gestalt dar. Die Klammerung durch das erste Buchkapitel und das drittletzte mit dem Titel Priori Incantatem, stellt das zentrale Ereignis dar, das die Geschehnisse der drei folgenden Bände ankündigt.
Der Feuerkelch ist im Sinne einer klassischen Plotvorlage also der Höhepunkt der gesamten Geschichte. Nach Exposition und aufsteigender Handlung in den drei ersten Teilen erreichen wir im vierten Band den Wendepunkt, auf dessen Basis die abfallende Handlung und die Auflösung in den drei Folgeromanen aufbauen.
Zauber- und Grauenhaftes
Nach den über hundert Zaubersprüchen und -objekten, die wir schon in den Vorgängerbänden kennengelernt haben, führt Frau Rowling zwei weitere magische Konzepte ein. Bislang reisten Zauberer entweder auf Besen oder mit Hilfe von Flohpulver von einem Kamin zum anderen. Fortgeschrittene beherrschten das Apparieren, also das Auflösen am Startort und das Erscheinen wie aus dem Nichts am Zielort. Und für weniger Versierte gab es da noch den Fahrenden Ritter, eine Art Nachtbus-on-demand für gestrandete Zauberer.
Nun kommt noch der Ortswechsel mit Hilfe von sogenannten Portschlüsseln hinzu. Dies sind verhexte Alltagsgegenstände, die jeden, der sie berührt, in Sekundenschnelle an einen zuvor festgelegten Landepunkt zerren – „Beam me up, Scotty!“
Einen solchen Portschlüssel braucht die Autorin, um Harry nach dem Trimagischen Turnier in die Hände seines Gegenspielers und danach wieder zurück nach Hogwarts zu befördern. Noch wichtiger als Portschlüssel aber sind Denkarien. Dabei handelt es sich um Aufbewahrungsschüsseln für Erinnerungen, also eine Art Tupperdosen für 3D-Erlebnisvideos in der Zaubererwelt. Frau Rowling verwendet solche Denkarien inflationär in den Bänden fünf bis sieben, um der Leserschaft längst vergangene Ereignisse rasch, plastisch und mit einem Anstrich von Objektivität zu erklären.
Magische Paparazzi
Bislang wurde die Handlung der rowlingschen Geschichte von einer klaren Bipolarität getragen: Harry Potter vs. Voldemort, zauberhafte Philantropen vs. Schwarzmagier, Gryffindor vs. Slytherin. Im vorliegenden Band erweitert die Autorin diese klare Front und fügt den Konfrontationen eine gehässige Guerillakomponente hinzu. In unserer freudlosen Muggelwelt operieren Boulevardreporter mit Agentenmethoden, Teleobjektiven und Wanzen, um an Material für die Regenbogenpresse zu kommen.
In der magischen Welt stehen den Paparazzi noch ganz andere Möglichkeiten offen. Da bekommt das Wort „Wanze“ gleich eine ganz andere Bedeutung. Als Personifizierung der rücksichtslosen Sensationsschreiberlinge sorgt von nun an die verabscheuungswürdige Rita Kimmkorn dafür, dass sich für Harry und die Seinen noch ein weiterer, nur schwer zu verteidigender Kriegsschauplatz auftut.
Erfolgsrezept
Bei meinem letzten Lesedurchgang ist es mir ganz besonders aufgefallen: Frau Rowling peitscht ihre Leserschaft geradezu durch die Romanhandlung. Da findet sich nirgends auch nur der Hauch eines überflüssigen Satzteils, kein Wort zuviel. Sogar das Spitzenspiel der Quidditch-WM packt sie in gerade mal elf Buchseiten. (Wofür man der Autorin dankbar sein muss. Denn die Quidditch-Passagen der ersten drei Romane hatten die Sportbegeisterung der Leser¦innen bis an die Grenzen ausgereizt.)
Dieser komprimierte Schreibstil hat zwei Auswirkungen: Zum Einen gelingt es der Autorin, eine ungeheure Fülle von Ereignissen in die 630 🇬🇧 beziehungsweise 750 🇩🇪 Textseiten zu packen. Und zum Zweiten sorgt sie damit dafür, dass die Leserschaft das Buch kaum mehr zur Seite legen will. Der Suchtfaktor ist enorm.
Da verzeiht man Frau Rowling schon mal eine ihrer Schreibschwächen. Gemütsverfassungen der handelnden Personen in ihre Texte einfließen zu lassen, ist nicht ihr Ding. Denn wann immer Harry mit psychisch Belastendem konfrontiert wird, leidet er sogleich unter schrumpfenden Eingeweiden, die sich womöglich mit Blei füllen oder durch herabfallende Gewichte zerquetscht werden.
~
Hat Dir diese Buchbesprechung gefallen? Dann interessierst Du Dich vielleicht auch für meine Rezensionen zu den anderen sechs Harry-Potter-Romanen? Du findest sie auf meiner Autorenseite über Joanne K. Rowling.
Fazit:
Mit Harry Potter und der Feuerkelch hat Joanne K. Rowling einen überraschenden, umfang- und inhaltsreichen vierten Romanband ihrer Serie über den Jungzauberer mit Vergangenheit abgeliefert. Strukturell bleibt sie ihrem angekündigten Konzept treu, nach welchem die Serie mit dem siebten Band enden soll. Und sie öffnet die zuvor in sich geschlossene Geschichte für alle möglichen zukünftigen Wendungen.
Aus meiner Sicht ist das ein sehr gelungener Übergangsroman. Wegen der ungeheuren Personaldichte der Vorgängerbände eignet sich der Feuerkelch allerdings nicht als Einstiegslektüre in den Potter-Zyklus, obwohl tatsächlich ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Wegen einiger formaler Schwächen gibt es Punkteabzug, so dass Harry Potters Feuerkelch knapp an den vier Sternen vorbeischrammt. Sehr gute drei der fünf möglichen Sterne bekommt er jedoch allemal.
Joanne K. Rowling: Harry Potter and the Goblet of Fire
| Harry Potter und der Feuerkelch
🇬🇧 Bloomsbury Publishing, 2000
🇩🇪 Carlsen Verlag, 2000
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)