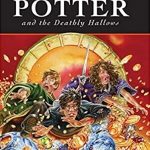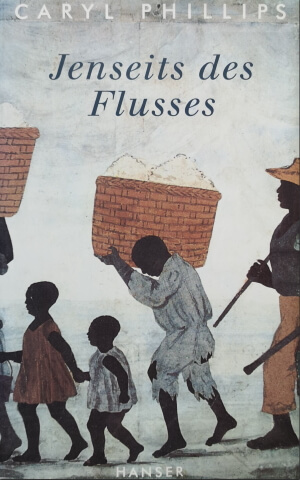
Jenseits des Flusses ist der fünfte Roman des Schriftstellers Caryl Phillips. In seinem Werk beschäftigt sich Philipps vorrangig mit den Themen Herkunft, Zugehörigkeit und Exklusion. In Jenseits des Flusses beleuchtet er die Hintergründe des afrikanischen Sklavenhandels in einer vierstimmigen Erzählung. Ihren Ursprung nimmt die Geschichte in einem Vorwort eines namenlosen afrikanischen Vaters, der soeben seine drei Kinder Nash, Martha und Travis an Sklavenhändler verkauft hat.
Der Autor Caryl Phillips ist selbst dunkelhäutiger Westinder, weder Jude noch Europäer oder Afrikaner. Aber er weiß wovon er spricht, wenn er Nationalismus und Rassismus als schlimmste Übel dieser Welt bezeichnet.
Phillips wurde 1958 auf der Karibikinsel St. Kitts geboren, wuchs in England auf, studierte in Oxford und lehrt heute mit gut sechzig Jahren in New Haven, USA, als Literaturprofessor an der Yale University. Er hat am eigenen Leibe erlebt, was es bedeutet, „ein farbiger Einwanderer“ zu sein.
Für seinen fünften Roman, der im Original Crossing the River heißt, hat er den Commonwealth Writers‘ Prize und den James Tate Black Memorial Prize erhalten und wurde für den Booker Prize nominiert.
I – Die Heidenküste
Im Jahr 1841 macht sich Edward Williams, ein wohlhabender weißer Amerikaner, daran, von New York aus an die afrikanische Westküste nach Liberia zu reisen. Er begibt sich auf die Suche nach Nash (!) Williams, einen seiner freigelassenen schwarzen Sklaven. Etwa ein Jahrzehnt zuvor hatte er Nash im Rahmen eines Programmes des Amerikanischen Kolonisierungsvereins nach Afrika geschickt. Dort sollte der ehemalige Sklave das Wort Gottes verbreiten. Doch der Kontakt zwischen Edward und Nash war abgerissen, das Schicksal Nashs unbekannt.
Wir lesen mehrere Briefe Nashs an Edward, die dieser nie zu Gesicht bekommen hatte. Über Jahrzehnte hinweg verwandelt sich der einst glühende Missionar Nash in einen einfachen ortsansäßigen Schwarzafrikaner, der an der Diskrepanz unterschiedlicher Kulturen und Wertesysteme scheitert. In seiner neuen Heimat hat er zuletzt christliche und amerikanische Ideale aufgegeben und will einfach nur noch überleben.
Schließlich strandet Edward auf seiner Suche in einer höchst primitiven, verdreckten Ansiedlung im Landesinneren, in der Nash gelebt hatte. Der Mann selbst war kurz zuvor verstorben.
Eine groteske, fürchterliche Geschichte, die bestens dazu geeignet sein könnte, den Leser in Agonie zu stürzen angesichts der Aussichtslosigkeit des menschlichen Daseins. Formuliert hat der Autor dieses Fragment in der gestelzten, antiquierten Sprache längst verblichener Generationen. Deren Ideale und deren Frömmigkeit werden zu Grabe getragen mit Nash und Edward Williams.
II – Im Westen
Martha (!) Randolph ist in die Jahre gekommen. Sie hat sich krumm geschuftet mit Sklavenarbeit. Wurde verkauft und dabei von Mann und kleiner Tochter getrennt. War geflohen und hatte es nach dem Ende der Sklaverei zwischenzeitlich zu bescheidenem Glück gebracht mit einem neuen Mann. Der wird erschossen und Martha bleibt nichts anderes übrig, als sich erneut auf den Weg zu machen: gemeinsam mit einem Treck ehemaliger Sklaven in den Westen. Doch die Alte behindert das Vorankommen des Trecks. Also lassen die Männer Martha im winterkalten Denver zurück, ohne jede Aussicht auf eine Zukunft oder auch nur auf Überleben.
Diese zweite Erzählung Phillips‘ besteht aus einer Serie von verschachtelten Flashbacks: Erinnerungen an gute wie an böse Zeiten. An die niemals vergessene, aber längst im Universum verschwundene Tochter Eliza Mae. Auch hier dominiert abgrundtiefe Resignation. Ein Wissen um die eigene Bedeutungslosigkeit, an der weder gutmeinende noch böswillige Nächste auch nur das Geringste ändern können. Ein Albtraum, der versickert im zweifellos bevorstehenden Tod Marthas.
III – Über den Fluss
Wir schreiben das Jahr 1752 und begleiten über das Logbuch der Duke of York ein englisches Sklavenschiff auf seinem Weg von Liverpool an die afrikanische Küste. Dort geht der 26-jährige Kapitän James Hamilton auf Einkaufstour und belädt das Schiff nach und nach mit afrikanischen Sklaven.
Fassungslos lesen wir, wie die Sklaven noch währende der Küstentour – begleitet von bedauerndem jedoch stets geschäftsmäßigem Achselzucken des Kapitäns – wie die Fliegen versterben. Außerdem scheinen Aufstände unter der menschlichen Fracht zur Tagesordnung zu gehören und werden erbarmungslos abgewürgt. Mit 210 Sklaven an Bord macht sich Hamilton schließlich auf den Weg über den Atlantik.
Das Geschäftsmäßige des Schiffstagebuches, in dem die haarsträubendsten Ungeheuerlichkeiten in einem oder zwei Halbsätzen geschildert werden, steht im Kontrast zu Liebesbriefen, die der Kapitän zwischendurch an seine in England verbliebene junge Frau schreibt.
Der Autor überlässt es der Fantasie seiner Leser zu erahnen, welche Dramen sich unter Deck in den Sklavenverschlägen abspielen, während Hamilton über Liebe und Familie plaudert.
IV – Irgendwo in England
Eine gewisse Joyce erzählt ihre Lebengeschichte irgendwo im britischen Norden. Zersplitterte Zeitfragmente, durcheinander geraten, so als ob Joyce ein Schuhkarton mit Notizzetteln heruntergefallen wäre. Mal ein kurzer Text aus 1942, mal einer aus 1936, dann aus 1963. Ein wildes Durcheinander hauptsächlich aus den Jahrzehnten um den zweiten Weltkrieg. Doch mit der Zeit kann die Leserschaft dem Autoren und seiner Joyce folgen:
Mit achtzehn von einem Schauspieler geschwängert, Abtreibung, Bruch mit der fanatisch religiösen Mutter. Wenige Jahre später Heirat mit einem Dorfladenbesitzer, der jedoch in den ersten Kriegsjahren wegen Schwarzhandels ins Gefängnis geht. Ankunft einer US-amerikanischen GI-Truppe. Tanzvergnügen und schließlich ein Verhältnis mit einem farbigen Amerikaner namens Travis (!).
Joyces Glück ist jedoch nur von kurzer Dauer. Als ein gemeinsames Kind unterwegs ist, heiraten Travis und Joyce. Doch der GI wird nach Italien abkommandiert und stirbt dort im Gefecht. Joyce gibt den „kaffeebraunen“ Jungen namens Greer zur Adoption frei. Erst achtzehn Jahre später, 1963, steht der junge Mann vor ihrer Tür, als Joyce längst ein neues Leben mit einem anderen Mann begonnen hat.
An und für sich liest sich die letzte der vier Erzählungen am versöhnlichsten. Ja, natürlich hat Joyce kein einfaches Leben. Allzu viel Glück ist ihr nicht beschieden. Ein solches Leben möchte wohl niemand führen müssen.
Aber das wahre Drama erkennen wir erst, wenn wir uns in die Position Travis‘ versetzen, der selbst niemals zu Wort kommt. Die Liebe zu Joyce ist von vorne herein zum Scheitern verurteilt. Als schwarzer GI hatte er schon unter seinen Kameraden zu leiden. Und ein Leben mit der Weißen Joyce in den USA war komplett unvorstellbar, das würde niemals erlaubt werden. – Gibt es überhaupt eine Perspektive, die Travis offen steht?
Durch die willkürliche Anordnung der Zeitfragmente dauert es eine Weile, bis der Leser erkennt, welch ungeheuerliche Willkür sich zusammenbraut und es zwei wirklich Liebenden verwehrt, eine gemeinsame Zukunft zu beginnen. Alleine nur deshalb, weil die beiden unterschiedliche Hautfarben haben.
~
Bewertung
Eine mühselige und darüber hinaus auch noch äußerst deprimierende Lektüre bürdet uns Caryl Phillips da auf. Gewiss, das Thema Sklaverei ließ von vorne herein keinesfalls erbauliche Lesestunden erwarten. Die Beschaulichkeit von Onkel Toms Hütte hatte ich auch nicht erwartet.
Nur 257 Seiten lang ist der Text. Aber dennoch breitet er die ganze Tragweite eines gesellschaftlichen Dramas aus, das sich die Menschheit in einer Zeitspanne von zwei Jahrhunderten aufgehalst hat, als sie damit begann, eine Klassengesellschaft durch Einteilung in Rassen zu schaffen. Dass wir dieses Problem auch heute noch längst nicht aufgearbeitet, geschweige denn beseitigt haben, zeigten zuletzt die Schicksale, die Martin Luther King am 4. April 1968, Eric Garner am 17. April 2014, oder George Floyd am 25. Mai 2020 erleiden musste.
Caryl Phillips hat seine Finger auf äußerst schmerzhafte Weise in eine Wunde gelegt, die wir uns aus Überheblichkeit, Willkür und Grausamkeit selbst zugefügt haben.
Fazit:
Wie noch keiner der zuvor gelesenen und besprochenen Romane hat mich Jenseits des Flusses in einem Dilemma zurück gelassen, das unauflösbar erscheint. Einerseits hat mich bei der Lektüre eine Empörung befallen, die einen Aufschrei unerlässlich scheinen lässt: Fünf Sterne, mindestens, für diese grauenhafte Erweckung; für diese meisterliche Schilderung eines menschlichen und gesellschaftlichen Skandals!
Andererseits befiel mich auch schreckliche Lethargie: So genau hatte ich das alles gar nicht wissen wollen. Die Lesestunden mit Caryl Phillips Geschichte waren alles andere als erfreulich. – Lesespaß? Gewiss nicht! Dafür kann man doch nicht mehr als einen oder zwei Sterne vergeben.
Letztlich habe ich mich mit einem unguten Gefühl im Bauch für drei der fünf möglichen Sterne entschieden. Und ich bin mir sicher: Dieses Buch werde ich kein weiteres Mal aus meinem Regal ziehen. Nicht etwa weil es schlecht wäre. Sondern weil ich es nicht noch einmal ertragen könnte.
Caryl Phillips: Jenseits des Flusses,
Carl Hanser Verlag, 1995