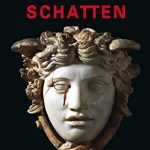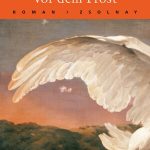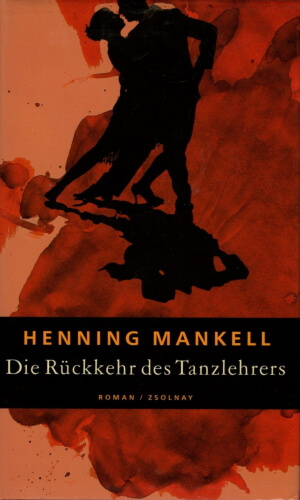
Als Henning Mankell im Jahr 1991 seinen ersten Kriminalroman unter dem Titel Mördare utan ansikte veröffentlichte, kannte den Autoren kaum jemand. Dies verwundert: Er ist nämlich mit der Theaterregisseurin Eva Bergman, Tochter des Filmregisseurs Ingmar Bergman, verheiratet und leitet in Mozambique eines der renommiertesten Theater Afrikas, das Teatro Avenida in Maputo. Zehn Jahre danach gehört Mankell zu den meist gelesenen Krimiautoren der Welt. Sein Debütroman wurde noch im Erscheinungsjahr zweifach als bester schwedischer Krimi ausgezeichnet und erschien 1999 als Mörder ohne Gesicht in deutscher Übersetzung. Für Die Rückkehr des Tanzlehrers erhielt Henning Mankell in diesem Jahr den Deutschen Bücherpreis in der Kategorie Publikumspreis.
[Nachtrag 2015:] Henning Mankell erlag am 15. Oktober 2015 im Alter von 67 Jahren einem Krebsleiden und wurde in Göteborg beigesetzt.
Hintergrund
Interessant an dieser Erfolgsgeschichte ist der Hintergrund ihrer Entstehung. Autor Mankell besitzt in der Nähe der südschwedischen Kleinstadt Ystad ein Sommerhaus, in dem er regelmäßig Urlaube verbringt. Ein realer, brutaler Überfall auf ein Bauernehepaar ließ in der Region Schonen eine Welle von Ausländerfeindlichkeit aufwallen.
Kurzerhand erfand Mankell die Figur des Kurt Wallander, den er in Mörder ohne Gesicht den Fall lösen ließ. Der Erfolg des Buches ließ dem Schriftsteller danach wohl kaum eine Wahl: Im Jahresrhythmus entstanden immer neue Thriller um Kommissar Wallander, insgesamt bislang neun Bände.
Mit dem Nachtrag Wallanders erster Fall schloss Mankell die Serie um den Kultpolizisten im Jahr 1999 – vorläufig – ab. Ein Jahr danach präsentierte er in seinem Roman Die Rückkehr des Tanzlehrers einen Nachfolger: Stefan Lindman, seines Zeichens Polizeikommissar in Borås.
Erfolgsrezept
In gewisser Weise begibt sich Henning Mankell mit diesem Neuanfang erneut zurück zu den Wurzeln. Hatte er einst Kurt Wallander in seinem eigenen Sommerdomizil wirken lassen, löst nun Lindmann seinen ersten Fall in Härjedalen, dem Heimatort des Autors.
Auch sonst verlässt sich Mankell auf das längst bewährte Erfolgsrezept.
Seine neue Hauptfigur ist ebenso wenig „Superbulle“, sondern wie Wallander ein sensibler, an sich und der Welt zweifelnder Mann. Der reagiert genau wie sein Vorgänger oft impulsiv. Er muss sich dazu zwingen, vernünftig zu bleiben und sich an Regeln zu halten – im Polizeidienst genau so wie in seinem Privatleben. Litt Wallander an einer ausgeprägten Midlife Crisis, so laboriert Lindman an einem soeben erst diagnostizierten Krebsleiden. Beide Mankell-Kommissare tendieren zu Selbstmitleid. Und sie handeln jeder vorhandenen Selbsterkenntnis zu Trotz als Egozentriker.
Wahrscheinlich liegt es an dieser Persönlichkeitsmixtur, dass Mankells Figuren nicht nur ausgesprochen authentisch wirken, sondern volle Sympathie beim Leser wecken. Man ermittelt nicht nur gemeinsam mit beiden Männern. Es fällt auch leicht, sich mit ihnen zu identifizieren.
Parallelen
Noch eine weitere Parallelität des neuen Romans mit der Wallanderserie fällt rasch auf: Auch dieses Mal ist der Hintergrund der Geschichte geprägt von Gesellschaftskritik.
Im vorliegenden Fall erweist sich das Mordopfer als überzeugter Nationalsozialist und Hitler-Kollaborateur. Darüber hinaus entsteht während der Ermittlungen das Bild einer im Hintergrund der schwedischen Gesellschaft stehenden und noch immer aktiv operierenden Randgruppe nationalsozialistisch gesinnter Vordenker und Mitläufer. Das Phänomen der „ewig Gestrigen“ macht nicht einmal vor Kommissar Lindmans eigener Familie halt.
Mankell zeichnet das historische Bild einer dunklen Seite der deutsch-schwedischen Vergangenheit. Er scheut sich nicht, mit dem Finger auf die realen neonazistischen Tendenzen des Landes zu deuten. Dennoch kann ich nicht umhin zu erwähnen, dass die Schilderungen sowohl der Vergangenheit, als auch aktueller Aktivitäten schwedischer Nazis auf mich etwas platt und abgedroschen wirkten.
In die gleiche Richtung geht meine Kritik am Motiv des ersten Mörders. Er tötet auf typisch mankellsche Weise mit äußerster Brutalität einen Mann, der in seiner Nazivergangenheit schwere Schuld auf sich geladen haben muss. Diese Last aus der Vergangenheit bauscht Mankell in mehreren Szenen zu einem gewaltigen, stets im Hintergrund drohenden Schrecknis aus. Ich war dann aber richtiggehend enttäuscht war, als der Mordauslöser endlich erklärt wurde.
Stil und Richtung
Im Vordergrund der Romanhandlung steht im unverkennbaren, mankellschen Stil eine spannungsgeladene Story, die davon lebt, dass sich die Ereignisse überschlagen. Immer wieder tritt das Unvorhersehbare und Überraschende ein. Wie schon bei Wallander wird solide polizeiliche Ermittlungsarbeit häufig in den Schatten gestellt von Zufällen und den intuitiven Reaktionen der handelnden Personen.
Auf diese Art und Weise gelingt es dem Autor, den Leser mitzureißen. Er jagt uns von einem in den nächsten Abschnitt. Damit verbannt er jeden Gedanken daran, das Buch auch nur zwischenzeitlich aus der Hand legen zu wollen, aus unseren Gehirnen.
Einer der stilistischen Tricks Mankells besteht darin, seine Romankapitel so spannend ausklingen zu lassen, dass man nach einer Fortsetzung geradezu lechzt. Folgeabschnitte beginnen jedoch regelmäßig mit unpersönlichen Formulierungen. Dadurch wird der Leser über einige Zeilen oder Absätze hinweg darüber im Unklaren gelassen, ob die vorher abgebrochene Szene nun fortgesetzt wird. Oder ob nun an einer anderen Stelle und aus einer anderen Pespektive berichtet wird.
Worum es geht
Zur Handlung in Kürze: Kommissar Lindman erfährt, dass er an Krebs leidet. Während der Wochen, in denen er auf den Beginn der Behandlung wartet, erfährt er vom Mord an seinem ehemaligen Mentor bei der Polizei, Herbert Molin. Mehr um sich von seiner Krankheit abzulenken als aus echtem Interesse an Molin reist Lindman in den Norden. Beim Versuch, etwas über seinen Ex-Kollegen zu erfahren, gerät er in die Mordermittlungen. Als auch der Nachbar des Opfers getötet wird, überstürzen sich die Ereignisse. Lindman kann sich den Geschehnissen nicht mehr entziehen, bis die Hintergründe aufgeklärt sind und zumindest einer der Mörder gestellt wird.
Der Plot erzählt eine plausible, nachvollziehbare Geschichte, die allerdings gegen Ende hin ein wenig durchsichtig wirkt. Weit vor dem Kommissar hatte ich bereits vermutet, wer hinter dem zweiten Mord steckte und welche Motive zu Grunde lagen. Ich bezweifle, dass diese Entdeckung meiner überdurchschnittlichen Intelligenz zuzuschreiben ist. Vielmehr befürchte ich, Mankell hat an einigen Stellen den Bogen überspannt, indem er allzu deutliche Hinweise einflocht. An der einen oder anderen Stelle legte er wohl nicht überzeugend genug falsche Fährten.
Glanzlichter
Zu den Highlights des mankellschen Erzählstils gehören vor allen Dingen all die nebensächlichen Details, die weder zur Handlung, noch zur hintergründigen Gesellschaftskritik beitragen und die der Autor in alle seiner Krimis so gerne einbaut.
Da ist zum Beispiel der Polizist Guiseppe Larsson, der Ermittlungsleiter, der unter seinem absurden Vornamen leidet. Den hatte er von seiner Mutter verpasst bekommen, weil diese vor Guiseppes Geburt für einen durch die Lande tingelnden, italienischen Schlagersänger in Liebe entbrannt war.
In die gleiche Kategorie gehören auch Details aus dem modernen Alltag, die Mankell aufs Korn nimmt: Mobiltelefone, die genau dann ausfallen, wenn man sie braucht. Oder die Unkontrollierbarkeit und inhaltliche Unschärfe des Internet. Ebenfalls schön zu lesen ist, wie Mankell seinem Misstrauen etwa gegenüber dem Phänomen des „nomadic workers“ Ausdruck verleiht, indem er Molins Tochter als schöne, reiche, allerdings unerreichbare und unsympathische Berufsreisende skizziert.
Ein weiterer Orientierungspunkt, der sich wie ein roter Faden durch sämtliche Bücher des Autors zieht, ist das Thema Alkoholismus. Schon bisher hatten viele der Figuren Mankells ein problematisches Verhältnis zum Alkoholkonsum, unter ihnen auch Kurt Wallander. Die Rückkehr des Tanzlehrers geht in Bezug auf diese Thematik noch weiter. Molins Mörder ist schwer alkoholkrank, und Henning Mankell weiß dessen Begehren nach dem Suchtstoff und die Momente des Eintauchens in den Rausch sehr eindringlich zu schildern.
~
Wer diese Buchbesprechung gern gelesen hat, wird sich vielleicht auch für Mankells Wallanderromane interessieren oder meine Themenseite über Kurt Wallander lesen wollen.
Fazit:
Die Rückkehr des Tanzlehrers ist ein sehr solider, mitreißend geschriebener Kriminalroman. Er bietet über die behandelten Verbrechen hinaus durchaus noch zusätzliche Qualitäten; etwa die gesellschaftskritischen Anmerkungen, oder die so nachvollziehbaren persönlichen Entwicklungsgeschichten der handelnden Personen. Wer Wallander liebt, wird auch Lindman mögen.
Allerdings setzt bei mir mittlerweile eine gewisse Abstumpfung beim Lesen von Mankells Krimis ein. Für sich allein genommen ist zwar auch dieser Roman gut gelungen. Im Kontext gesehen wirkt das Konzept jedoch nicht mehr ganz taufrisch. Der vollmundigen Vorankündigung des „vielleicht besten Mankells“ kann ich jedenfalls nicht anschließen. Drei von fünf Sternen gibt es für Kommissar Lindman. Obwohl ich zugegebener Maßen wahrscheinlich vier vergeben hätte, wäre Die Rückkehr des Tanzlehrers mein erster Mankell gewesen.
Henning Mankell: Die Rückkehr des Tanzlehrers
Paul Zsolnay Verlag, 2002
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)