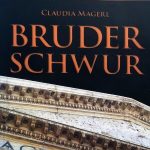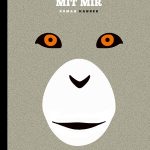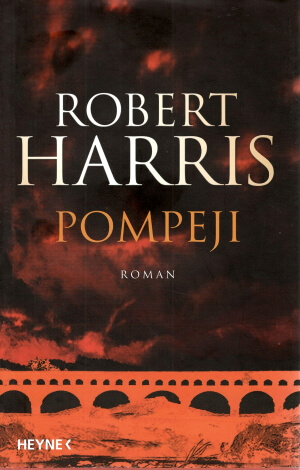
Wir schreiben das Jahr 79 n.Chr. Die Weltmacht Rom erlebt eine Zeit historischer Blüte. Erfüllt von Stolz auf das politische Sytem, kulturelle Errungenschaften und wissenschaftliche Glanzleistungen zehren die römischen Bürger von den Anstrengungen ihrer Ahnen, denen sie ihr zufriedenes und sattes Leben verdanken. Die Erwartungshaltung der Römer ist groß; die Bereitschaft des Einzelnen, eigene Beiträge zur Erneuerung zu leisten, hingegen minimal. Denn über der Gesellschaft der Reichen und Arrivierten liegt der modrige Geruch von Übersättigung, Gleichgültigkeit und Egozentrizität.
Pompeji: Ein Modell dieser selbstgefälligen Wohlstandsgesellschaft findet sich in den Sommermonaten am Golf von Neapel ein. Dank der Aqua Augusta, einer bautechnischen Meisterleistung, die den ausgedörrten Süden mit frischem Wasser im Überfluss versorgt, führt die römische Oberschicht in ihren Feriendomizilen ein ausschweifendes Leben. Doch mit einem Donnerschlag zerstört der Ausbruch des Vulkans Vesuv den römischen Mikrokosmos am Golf.
Historische Parallelen
Das Szenario kommt auch dem Leser bekannt vor, der in seiner Schulzeit nicht in den Genuss eines mehrjährigen Lateinunterrichts kam. Denn der Autor Robert Harris baut unübersehbar bereits in den Vorbemerkungen Parallelen zu New York und implizit auch zum Attentat am 11. September 2001 auf. Harris basiert seinen Erfolgsroman ganz bewusst auf Ähnlichkeiten zwischen der historischen Weltmacht Rom und den gegenwärtigen Verhältnissen in den USA.
Damit gibt er dem Buch trotz der weit in der Vergangenheit liegenden Handlungszeit eine aktuelle Komponente, die dazu beiträgt, das Interesse der Leserschaft zu steigern. Wer möchte, kann den Kontext durchaus auch auf andere traumatische Begebenheiten der neueren Geschichte ausdehnen: Zum Untergang der Titanic oder dem Schock nach dem Angriff Japans auf Pearl Harbour lassen sich durchaus Parallelen ziehen.
Über die Handlung
Worum geht es also in Pompeji? – Vor dem beschriebenen geschichtlichen Hintergrund findet sich nur vier Tage vor dem vollkommen überraschenden Untergang der Stadt Pompeji der Wasserbauingenieur Marcus Attilus in der Region am Fuße des Vesuv ein. Denn das Bauamt in Rom hat ihm die Verantwortung für das Aquädukt Aqua Augusta übertragen. Über die Wasserleitung wird die gesamte Gegend mit Frischwasser versorgt.
Eine der ersten Amtshandlungen des „Aquarius“ besteht in der Reparatur einer Störung, durch die der Nordwestzweig des Aquädukts ohne Wasser bleibt. Getrieben zunächst von der Dringlichkeit der Wasserversorgung, später durch die nahende Naturkatastrophe jagt der Protagonist durch die rasante Abfolge der Ereignisse. Dabei erspart ihm sein geistiger Vater nichts.
Attilus kämpft gegen die Ablehnung durch seine Arbeiterschaft. Er muss sich außerdem bei den lokalen Polit- und Militärgrößen durchsetzen. Und er verliebt sich unglücklich und deckt darüber hinaus ganz nebenbei einen Korruptionsskandal um das kostbare Nass in Pompeji auf. Dieser Skandal endet allerdings angesichts des dramatischen Endes der Stadt in relativer Bedeutungslosigkeit.
Bewertung
Harris‘ Roman kämpft von vorne herein gegen eine Schwierigkeit an: Der Ausgang der historischen Rahmenhandlung ist einer überwiegenden Mehrheit der Leser bekannt. Er birgt also keinerlei Überraschungsmoment. Auch die personengebundenen Handlungsstränge der Geschichte sind nicht in der Lage, das Buch in die Kategorie des Thrillers einzuordnen.
Trotzdem gehört Pompeji zu den Texten, die man kaum aus der Hand legen kann, wenn man einmal zu lesen begonnen hat. Dies liegt sicher am Talent des Autors, Spannung nicht nur aufbauen, sondern auch über längere Strecken aufrecht erhalten zu können. Darin liegt eine der Stärken des Romans.
Das zweite Plus der Geschichte besteht in der gründlichen Recherchearbeit, auf die Robert Harris sein Buch aufbaut. Jedes Kapitel wird mit einem Zitat aus einer naturwissenschaftlichen Arbeit zu den Abläufen und Zusammenhängen bei Vulkanausbrüchen eingeleitet. Schnell wird klar, dass die Inhalte der Zitate im zeitlichen Zusammenhang mit den Geschehnissen des Kapitels stehen. Allein schon dadurch gewinnt ein jeder der Abschnitte an Moment, noch bevor die Handlung sich entwickelt hat.
Das größte Lesevergnügen bereiteten jedoch – zumindest mir – weder die historische, noch die erfundene Romanhandlung. Die eindrucksvollsten Passagen gelingen Harris, wenn er das Lokalkolorit wiedergibt. Ob es sich nun um Beschreibungen der Gebäude, der Kleidung oder der Gewohnheiten der antiken, römischen Bevölkerung handelt, stets hat der Leser den Eindruck, er stünde direkt neben dem Protagonisten.
Einordnung
Dies bedeutet allerdings nicht, dass man beim Lesen stets lustvoll am römischen Leben teilnähme. Einige der geschilderten Szenen sind eher dazu geeignet, den Leser sich mit Grausen abwenden zu lassen. Wenn Sklaven bei lebendigem Leib an Muränen verfüttert werden, oder wenn sich dekadente Römer durch abwegige sexuelle Praktiken aus ihrer Übersättigung befreien wollen, dann ertappt man sich schon mal beim Gedanken, dass man selbst glücklicherweise nicht in solchen Zeiten lebt. (Obwohl es die Ehrlichkeit geböte einzuräumen, dass Grausamkeit heute schlicht und einfach andere Rahmen und Dimensionen bekommen hat.)
Das römische Sittengemälde, das Harris so plastisch entstehen lässt, gehört auf jeden Fall zu den Glanzlichtern seines Romans. Gleiches gilt im übrigens für technische Einzelheiten, die Robert Harris zum Beispiel über die beruflichen Kenntnisse seines protagonisten Attilus an die Leser vermittelt.
Die personelle Handlung um den Aquarius, um den historischen Feldherrn Gaius Plinius, den skrupellosen Katastrophenprofiteur Ampliatus und dessen Tochter Corelia kommt in der rasanten Handlung zu kurz. Was Harris an Persönlichkeitsbildern und -beziehungen entwickelt, entspricht leider nur dem Niveau eines Groschenromans.
Damit verspielt er die Möglichkeit, seinem Buch wirklich imposante Dimensionen zu verleihen. Zum bereits angesprochenen Kontext etwa von Pearl Harbour zeigt Schnee, der auf Zedern fällt, was möglich gewesen wäre. Hätte sich der Autor nur seiner Möglichkeiten besonnen und das Thema nicht durch einen zu kurz geratenen Schnellschuss abgefackelt.
~
Übrigens: Wem Pompeji in seiner historischen Dimension gefällt, der hat vielleicht auch Interesse an meiner Buchbesprechung von Claudia Magerls Der Tempel des Castor.
Fazit:
Pompeji ist ein spannungsgeladener Roman, den man am liebsten an einem Stück verschlingen möchte. Die Detailverliebtheit des Autors macht das Buch darüber hinaus zu einem Leckerbissen für geschichtlich, wie auch populärwissenschaftlich interessierte Leser. Selbst wer weiß, was aus dem historischen Pompeji wurde, wird von der bildhaften Schilderung des Untergangs beeindruckt sein.
Leider gestattet es der Autor Harris seinen Romanfiguren nicht, sich zu Persönlichkeiten zu entwickeln, deren Gedanken und Handlungen man nachvollziehen oder auch ablehnen könnte. Die Figuren der Geschichte kommen nicht über das Stadium stereotypischer Schwarzweiß-Gestalten hinaus. Dies ist um so bedauerlicher, als Robert Harris eine derartige Einschränkung nicht nötig hätte. Schade; so kommt sein Pompeji leider nicht über drei von fünf Sternen hinaus.
Robert Harris: Pompeji
Heyne Verlag, 2004
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)