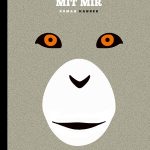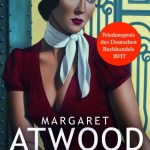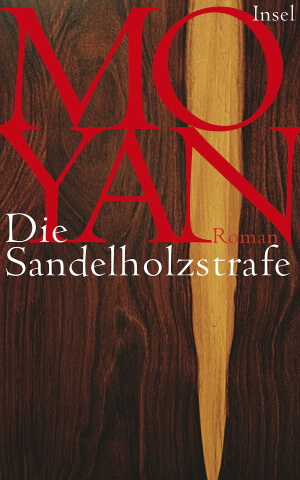
Im Jahr 2001 erschien das Original des Romans Die Sandelholzstrafe von Mo Yan. Der chinesische Schriftsteller wurde elf Jahre später mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Mit Nobelpreisträgern ist das ja immer so eine Sache. Es gibt fast immer Kommentare, nach denen der eine oder andere Preisträger nicht würdig sei; weil sie oder er in Wirklichkeit nichts dafür getan hätte, das die Verleihung rechtfertigen könne; weil sie den Preis nur als Quotenfrau bekommen habe; weil er ihn ohnehin nur stellvertretend für diese oder jene gesellschaftliche Gruppe erhalten habe; oder weil ja eigentlich endlich der Kollege N.N. dran gewesen sei, das gäbe es doch nicht, dass der noch immer nicht …
Das gilt insbesondere für die populärsten Preiskategorien, zu denen gefühlt jeder der sieben Milliarden Menschen auf unserem Planeten mitreden zu können meint. Also insbesondere für den Friedensnobelpreis und für den Literaturnobelpreis. Derlei Diskussionen erheitern mich meist sehr, ich lese sie gerne, all diese Tiraden und Analysen, das Gestreite, die Empörung. Aber letztlich interessiert mich das ganze Gezerre ungefähr so sehr, als ob in China ein Reissack umfiele.
Und mit diesem Reissack sind wir auch schon beim aktuellen Fall angekommen. Der Literaturnobelpreis wurde also 2012 dem chinesischen Schriftsteller Mo Yan verliehen. Das Geschrei war sogleich groß. Quer durch die Bank fanden sich prominente Kritiker, die Mo Yan vorwerfen, er habe sich mit dem diktatorischen chinesischen Regime arrangiert. – Ich erlaube mir den Luxus, zur Debatte keine Meinung haben zu dürfen und statt dessen einen Roman von Mo Yan zu lesen: Die Sandelholzstrafe.
Über die Romangeschichte
Für dieses Buch habe ich mich entschieden, nachdem ich beim Buchhändler meines Vertrauens in den Vor- und Nachworten verschiedener Werke des Schriftstellers geschmökert hatte. Im Nachwort zur Sandelholzstrafe, das man übrigens durchaus vor der Lektüre der Geschichte lesen sollte, schreibt Mo Yan:
Diese Erzählform lehnt sich stark an volkstümliche Romanzen an und bedient sich daher einer Sprache, die von überlieferten populären Redeweisen und Gesängen geprägt ist.
[…] sowenig ist zu erwarten, daß mein Roman den Gefallen von Liebhabern westlicher Literatur, insbesondere solchen mit hochintellektuellem Anspruch, findet.
Handlung
Dann wollen wir mal sehen, ob wir nicht doch Gefallen an dem Roman finden können. Die Geschichte ist im Grundsatz einfach gestrickt. Sie handelt im China der europäischen Kolonialzeit zum Wechsel des neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert, als deutsche Ingenieure und Soldaten den Eisenbahnbau vorantreiben.
Die Protagonistin und Dorfschönheit Sun Meiniang ist mit dem geistig minderbemittelten Hunde- und Schweinemetzger Xiajiao verheiratet. Sie tritt aber gleichzeitig offen als Geliebte des Kreispräfekten Qian Ding auf. Der schönen Meiniangs Vater, Sun Bing, war zunächst Hauptdarsteller einer Schauspielertruppe, die die beliebten Katzenopern aufführte. Als rebellischer Geist, der er ist, wendet sich Sun Bing jedoch dem Widerstand gegen den Eisenbahnbau zu, nachdem seine Frau von deutschen Kolonialisten belästigt wurde.
Daraufhin sieht sich, auf Weisung des mächtigen Generals Yuan Shikai, der Präfekt gezwungen, den Vater seiner eigenen Geliebten festzusetzen und ihm den Prozess machen zu lassen. Doch es kommt noch schlimmer: Ausgerechnet der Vater des Schweinemetzgers und Schwiegersohnes des Verurteilten, einst Henker am Kaiserhof, Zhao Jia, soll zur Abschreckung die grausame Sandelholzstrafe an Sun Bing vollstrecken. Die Situation eskaliert.
Erfolgsfaktoren
Der Autor Mo Yan erzählt diese Geschichte aus wechselnden Perspektiven aller Beteiligter. Dabei bedient er sich eben dieser „Sprache, die von überlieferten populären Redeweisen und Gesängen geprägt ist“. Es entwickelt sich eine farbenfrohe, für europäische Ohren ungewohnte Erzählung, der man mit Neugier und Freuden folgt und sich dabei an der besonderen chinesischen Erzählweise ergötzt.
Natürlich bringt es die Geschichte mit sich, dass auch der Henker Details aus seiner Profession zum Besten gibt. Die Profession des Henkers ist in unserer europäischen Vorstellung mit Äxten oder Fallbeilen verbunden: kurz und zack. Im historischen China handelte es sich jedoch um mehrtägige oder -wöchige Zeremonien, bei denen die Todeskandidaten möglichst lange am Leben gehalten wurden, damit sie in den vollen Genuss eines wahrhaft qualvollen Todes kommen konnten. Da schluckt man schon mal, wenn ausführlich von Hinrichtungen die Rede ist, bei denen aus dem Verurteilten nach und nach mit hohem Zeitaufwand ein paar hundert Stückchen des Körpers herausgeschnitten werden, bevor der arme Kerl endlich zu Tode kommen durfte. Was gar mit der Sandelholzstrafe verbunden war, mag ich hier auf keinen Fall schildern. Grausig ist das wohl, also nichts für zarte Gemüter.
Aber andererseits reihen sich solche Sequenzen nahtlos in die Alltagsgeschichten der chinesischen Dorfbewohner und kaiserlichen Beamten ein, so dass der Leser nicht das Gefühl hat, sich ausschließlich mit sadistischen Gewaltfantasien chinesischer Potentaten befassen zu müssen.
Bewertung
Folgerichtig widerspreche ich Herrn Mos Vermutung, Fans westlicher Literatur würden an der Sandelholzstrafe keinen Gefallen finden. (Also am Roman, nicht an der Strafe selbst.) Es wäre umgekehrt durchaus fraglich, ob mich eine Erzählung über die – sagen wir mal – bayerische Landbevölkerung im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert hinter dem Ofen hervorgelockt hätte. Diese chinesische Geschichte war für mich jedoch inhaltlich und stilistisch vollkommen neu und hat mir ausnehmend gut gefallen.
Vielleicht lag es ja auch an der Verwendung der alten Rechtschreibung („daß“, „helleuchtend“), die der Sandelholzstrafe in deutscher Übersetzung zusätzliche Authentizität verliehen hat; obwohl ich vermute, dass dies nicht in der Absicht von Verlag (Insel) und Lektorat lag. Vielleicht müsste man dazu einmal die Übersetzerin, Karin Betz, befragen.
Ja, ich finde, das hat Meister Mo wirklich prima angelegt. Auf der einen Seite stehen die fünf Protagonisten (die Familie um Meiniang und ihr Geliebter) mit ihren ganz persönlichen Ärgernissen, Wünschen und Plänen; und auf der anderen die herzlose Welt mit ihren Machtspielen und Intrigen, die wahrscheinlich vor über hundert Jahren bereits mindestens so grausam empfunden wurde wie heute. Trotz der aufgesetzten Heiterkeit ist es eine traurige Geschichte, die der Nobelpreisträger uns auftischt.
Und was den „hochintellektuellen Anspruch“ angeht – das möchte ich zum Schluss meiner Besprechung noch sagen – betreibt Mo Yan ebenfalls Understatement. Allein schon die Anlage der Erzählung als rekursive Struktur, treibt einem Fan von Gödel, Escher, Bach die Tränen ins Leserauge: In der Redeweise der Katzenoper geschrieben enthält der Text immer wiederkehrende Hinweise auf eine existierende Katzenoper mit dem Titel „Die Sandelholzstrafe“, die ihrerseits offenbar die Geschichte des Romans zum Inhalt hat.
~
Fazit:
Es muss gesagt werden, Die Sandelholzstrafe ist keine einfache Lektüre. Stilistisch ungewohnt und inhaltlich zum Teil brutal und schockierend könnte der Roman den einen oder die andere Leser¦in überfordern. Man benötigt Durchhaltevermögen und ein stabiles Nervenkostüm. Aber dann lohnt sich die Lektüre unbedingt. Bis dahin hatte ich noch keinen derartigen Einblick in eine mir fremde Kultur erhalten.
Bei aller öffentlicher Kritik, auf die ich am Anfang dieses Beitrages eingegangen bin, muss ich dringend ein paar Lanzen für Mo Yan brechen und vergebe für die Sandelholzstrafe hiermit vier von fünf möglichen Sternen. Mit deutlicher Tendenz zu den vollen fünfen.
Mo Yan: Die Sandelholzstrafe
Insel Verlag, 2009
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)