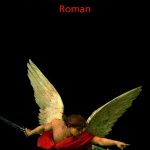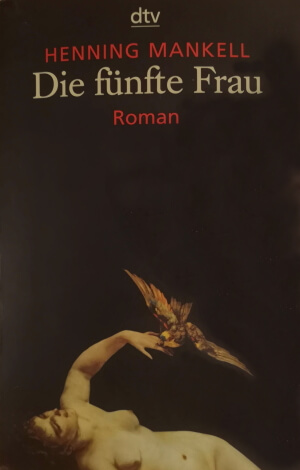
Der sechste von insgesamt zwölf Wallanderromanen trägt den Titel Die fünfte Frau. Die Geschichte handelt im Herbst des Jahres 1994. Henning Mankell hat diese Folge eng an die Handlung des vorangegangenen Bandes, Die falsche Fährte, geknüpft: Im Sommer ’94 hatte Kurt Wallander die „falsche Fährte“ verlassen und konnte einen vierfachen Serienmord aufklären. Danach macht er Urlaub mit seiner romantischen Partnerin Baiba und fliegt im Anschluss mit seinem Vater für ein paar Tage nach Rom. Direkt nach seiner Rückkehr aus der Ewigen Stadt wird der Kommissar in den Strudel einer weiteren Mordserie gezogen. Denn ein skrupelloser Killer beginnt im September ’94, scheinbar unbescholtene Männer zu töten. – Zwei Romane, die im gleichen Jahr handeln und die das gleiche Thema reflektieren: Rache und Selbstjustiz.
Fast macht es den Eindruck, als habe der Autor das Romanthema nicht in einem Band abschließen können. Die fünfte Frau wirkt nämlich nicht nur wegen des unmittelbaren zeitlichen Anschlusses wie eine Verlängerung der falschen Fährte. In vielerlei Hinsicht macht der sechste Wallanderroman auf mich den Eindruck einer ganz besonders exemplarischen Folge der Geschichten um den schwedischen Kult-Polizisten aus Ystad.
Afrika
Nachdem sich Mankell bereits im dritten Band, Die weiße Löwin, mit politischen Ereignissen in Südafrika beschäftigte, kommt er nun in der sechsten Romanfolge erneut auf den afrikanischen Kontinent zu sprechen. Bekanntlich verbrachte der Autor viel Zeit seines Lebens in Mosambik. Das Nachwort zur fünften Frau schrieb Mankell im April 1996 in Maputo.
Diesmal beginnt er seinen Roman mit einem kurzen Prolog, der sich im Jahr 1993 in Algerien zuträgt. Eine Gruppe religiöser Fundamentalisten dringt in ein christliches Kloster in der Stadt El Qued ein und schneidet vier französischen Nonnen die Kehlen durch. Eine zufällig anwesende „fünfte Frau“, Touristin aus Schweden, wird ebenfalls ermordet. Dieser gewaltsame Tod sollte ein Jahr danach zum Auslöser der Mordserie im schwedischen Schonen werden.
Über die afrikanische Ouvertüre hinaus legt Mankell im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen auch eine Spur, die bis in die Fünfzigerjahre zurückreicht. Denn damals waren an Unabhängigkeitskriegen in Belgisch-Kongo, dem heutigen Zaire, viele europäische und eben auch schwedische Söldner beteiligt. Im Haus des ersten Mordopfers findet Wallander Spuren, die auf eine dieser Söldnertruppen hinweisen.
Ermittlungsarbeit à la Wallander
In mehreren meiner mankellschen Buchbesprechungen habe ich nun schon über die akribische Ermittlungsarbeit geschrieben, durch die sich Wallanders Vorgehensweise auszeichnet. Dabei handelt es sich um Spurensuche, die nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen führt, die aber Mankell gern und ausführlich in seine Romantexte einbindet, um die Polizeiarbeit zu illustrieren. Ich will nun einmal eine dieser toten Spuren beschreiben, die besonders beispielhaft ist für das Prozedere des Ermittlerteams in Ystad:
In einem geheimen Safe findet die Polizei einen Schrumpfkopf, alte Fotografien und das Tagebuch eines schwedischen Söldners. Jedes dieser Objekte nehmen sie sich nun einzeln vor. Über eines der Fotos identifizieren sie einen Mann, der für Geld in verschiedene Kriege zog. Diese Figur führt Wallander über verschlungene Pfade weit entfernt in den Norden Schwedens – zu einem Personalberater der besonderen Art, der professionelle Kämpfer in die ganze Welt vermittelt. Doch der gesuchte Söldner hat sich, so zeigt die Vernehmung des Vermittlers, bereits sieben Jahre zuvor aus Überdruss das Leben genommen.
„Bestimmte Teilchen ihres Ermittlungspuzzles hatten keinen anderen Wert als den, daß sie an ihrem Platz liegen mußten, damit sie die wichtigsten Teile an den richtigen Punkt legen konnten.“
(Seite 316)
Der tote Söldner war also ein solches nebensächliches Teilchen. Ein langer und ausführlich beschriebener Weg, der über annähernd 300 Buchseiten mäandert, erweist sich als Sackgasse. Dem Erzähltalent Mankells ist es zu verdanken, dass solche Ermittlungspfade, die mal abtauchen, mal wieder an die Oberfläche steigen, die ganze Zeit über interessant bleiben und bei der Leserschaft nicht zu Langeweile führen. Seinen Kommissar lässt der Autor in den unvermeidlichen Augenblicken der Wahrheit sagen:
„Wir müssen tiefer graben.“
(z. B. Seite 313)
Der symbolische Unteroffizier
Also beginnen die Ermittler eben damit, tiefer zu graben. Das ist immer ermüdend und mit hohem Aufwand verbunden. Die meiste Zeit der Romangeschichten sind die handelnden Polizisten überarbeitet und übermüdet. Stets schwebt ein Damoklesschwert über der Truppe, das den Faden der Ermittlungen durchtrennen würde, falls auch nur noch ein einziges weiteres Puzzleteilchen hinzukommen sollte.
Natürlich kommen in solchen Situationen stets genau diese weiteren Teilchen hinzu. Aber obwohl die Kriminalisten die ganze Erzählung über immer an der Grenze des Machbaren agieren, schaffen sie es trotzdem jedesmal, die zusätzliche Belastung auch noch zu stemmen. Selbst dann, wenn sie kurz vor dem Aufgeben stehen. Denn:
„Es war Wallander noch nie gelungen, den symbolischen Unteroffizier in seinem Inneren zu besiegen, der überwachte, daß er tat, was er tun mußte.“
(Seite 303)
Worum es geht
Da ist zuächst die Kriminalhandlung des Romans. Innerhalb kurzer Zeit werden die Leichen dreier unbescholtener, harmlos wirkender Männer entdeckt. Ein pensionierter Autohändler, der Vogelgedichte schreibt, stürzt in angespitzte Bambuspfähle; ein Orchideenliebhaber wird erwürgt an einen Baum gefesselt aufgefunden; und ein mediokrer Chemiker wird in einen Sack gesteckt und ertrinkt darin in einem See. Die Polizei sucht nach einem Sadisten.
Doch bald wird klar, dass die drei Mordopfer so unschuldig gar nicht waren. Der erste Anschein trog! Die Ermittlungen ergeben nämlich, dass alle drei gewalttätig gegen Frauen waren. – An dieser Feststellung zäumt Henning Mankell nun den zentralen Punkt seiner Gesellschaftskritik auf. Kritik an einer Gesellschaft, in der sich noch immer Männer ungestraft an Frauen vergehen dürfen. Sie seelisch und körperlich misshandeln oder gar töten, ohne dass sie Konsequenzen zu spüren bekämen; weil die Gesellschaft eben gar nicht so genau hinsehen will.
Ein kühner Spagat
Von diesem systembedingten Unrecht bis zur Selbstjustiz durch Racheengel ist es nur ein kleiner Schritt. In diesem Spannungsbogen gelingt dem Autor ein kühner Spagat. Auf der einen Seite schildert er die ungeheure Grausamkeit der Morde, die er Wallander als das Schlimmste bezeichnen lässt, was dieser je zu Gesicht bekommen habe. Andererseits macht er auch die ungeheuerlichen Schrecken deutlich, die die Mordopfer ihrerseits Frauen angetan hatten und die zu den Racheakten führten. – Was ist denn nun schlimmer? Ungesühnte Grausamkeit in menschlichen Beziehungen? Oder das brutale Rächen solcher Ungerechtigkeit? Auge um Auge, Zahn um Zahn?
Eine eindeutige Stellungnahme vermeidet Mankell. Nach der Festnahme der Serienmörderin lässt er seinen Protagonisten die Verhöre eher unberührt und ohne Wertung durchführen. Allerdings weist der Autor in einer Nebenhandlung sehr deutlich auf die Gefahr von Selbstjustiz hin. Als sich in Schonen Bürgerwehren bilden und von diesen ein Unschuldiger um ein Haar umgebracht wird, geht Wallander mit aller Härte gegen ungesetzliche Selbstjustiz vor.
Meine Wertung
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich Die fünfte Frau als ersten der Wallanderromane gelesen habe. Nach einer Empfehlung durch eine Leihbibliothekarin in meinem Sommerurlaub im Jahr 1998 habe ich mich atemlos durch die spannende Geschichte durchgekämpft. Ich fürchte, ich war damals kaum mehr ansprechbar für meine Miturlauber; ich wurde mit dem Ystad-Virus infiziert und zum Fan des Schwedenkommissars.
Etwas Vergleichbares hatte ich bis dahin noch nicht gelesen. Der Roman bietet eine außergewöhnliche, beinahe eigenartig zu nennende Mischung aus grausiger Fallbeschreibung im Stile eines Thrillers, andererseits eintöniger Ermittlungsarbeit, die aber doch nicht langweilig wird, und hinter der Handlung stehender Kritik an einer Gesellschaft, die aus den Fugen zu geraten droht. Garniert wird die Geschichte mit kurzen afrikanischen Details, die Henning Mankell ein persönliches Anliegen sind, sowie mit der sich im Hintergrund dahin windenden Familiengeschichte des Protagonisten Kurt Wallander. – Dieses Paket hat es wahrlich in sich!
~
Notiz am Rande: Die fünfte Frau und der Papagei? Auch in die Gestaltung des sechsten Wallanderromans hat der Deutsche Taschenbuchverlag ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert einbezogen. Hier hat der Künstler Gustave Courbet helfend Hand angelegt. Der Titel zeigt einen Ausschnitt seines Gemäldes Frau mit Papagei (1866), einer Provokation des französischen Malers des Realismus, die im Original in The Metropolitan Museum of Art in New York ausgestellt ist.
Wer diese Rezension gern gelesen hat, wird sich wahrscheinlich auch für Buchbesprechungen anderer Wallanderromane interessieren oder meine Themenseite über Kurt Wallander ansehen wollen.
Fazit:
Wie schon sein Vorgänger ist mir auch Die fünfte Frau eine uneingeschränkte Leseempfehlung wert. Mankells Danksagungen in der Nachschrift zum Roman lassen erahnen, wieviel Arbeit in diesem sechsten Band der Krimiserie steckt. Für mich war die Folge nicht nur mein allererster Wallander; sie gehört auch unbedingt zu meinen persönlichen Highlights der Ystad-Romane.
Wen wundert’s? Ich möchte auch der fünften Frau nicht weniger als vier von fünf möglichen Sternen verleihen. An der Höchstwertung ist die Geschichte nur knapp vorbeigeschlittert.
Henning Mankell: Die fünfte Frau
Deutscher Taschenbuchverlag, 1998
* * * * *
Wenn Du über diese Links bestellst, erhalte ich eine kleine Provision auf Deinen Einkauf (mehr darüber)